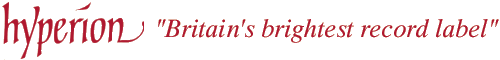
Welcome to Hyperion Records, an independent British classical label devoted to presenting high-quality recordings of music of all styles and from all periods from the twelfth century to the twenty-first.
Hyperion offers both CDs, and downloads in a number of formats. The site is also available in several languages.
Please use the dropdown buttons to set your preferred options, or use the checkbox to accept the defaults.



The six sonatas BWV525-530 are unique. Recent work on the sources, particularly John Butt’s article in The Organ Yearbook No 19, confirms various likelihoods: that the last sonata (BWV530) was composed from scratch as an organ sonata, probably independent of the others, and was perhaps the first to be so created; that others contain one or more movements transcribed for organ from their original version, although fewer movements may be transcriptions than was once thought; that the order and number were not fixed before the compilation was complete, and that the first of the set (BWV525) may have been added to the others, intended originally perhaps as No 5. These and other conjectures on the composer’s copy, which to some extent was being worked on as it was being made—there being no simple fair copy, in other words—lead one to think that despite its apparent neatness of conception, the set was indeed something rather experimental for Bach and that had he ever made a totally fair copy, some aspects, particularly the title and the order, would have been re-thought. For example, had BWV525 been moved to the penultimate position, the key plan would accord more closely with other sets of pieces in the composer’s oeuvre: c d e C E flat G is comparable, for instance, to B flat c a D G e of the Partitas for harpsichord.
The uncertainty over Bach’s intention in this respect leaves some room for manoeuvre for the modern recording artist. Taking advantage of this, Christopher Herrick has devised an order for this recording which juxtaposes strong contrasts of mood and style, and starts and finishes with two of the most exciting and extrovert movements in the set.
Musically it is reasonably clear what Bach’s self-given task was: to make a set of organ works equivalent to chamber sonatas in specific Italian or Italianate genres. But the equivalence is not straightforward. Firstly, the three-movement plan of five of the sonatas is closer to contemporary Italian concertos than to string sonatas. Secondly, the counterpoint of the two upper voices is far more rigorous than in virtually all Italian trio sonatas, even Handel’s, and resembles more closely the invertible textures of trios in the form of organ chorales such as were composed by most Lutheran organists who put pen to paper. Thirdly, there is here a ‘miniaturisation’ as well as a ‘tidying up’ of the Italian sonata/concerto; the musicianship required of the player seems rather out of proportion to the brevity and succinctness of the works themselves, qualities that Bach would have found more in Corelli than Vivaldi. Completely Italian, on the other hand, are the details of the ritornello movements and the two versions of binary form (slow middle dance, fast finale). The ritornello-fugue finales represent a very conscious imitation of an ideal Italian chamber fugue. In shape and melody they resemble neither the ‘German organ fugue’ nor the ‘chamber keyboard fugue’ of which Bach had composed many examples by then (for example the big organ fugues in C, D, D, g etc, and Book One of The WelI-Tempered Clavier respectively). Furthermore, to the extent to which they are Italianate, the sonatas are also like string music: Italian and strings are almost synonymous here, and such a movement as the finale to BWV529 is, in detail, very close Indeed to Bach’s usual interpretation of Italian string counterpoint. Yet the end result is a set of pieces that one would never mistake for Italian chamber music, nor, with the exception of certain chorale-trios, for the German organ genres. Similar points could be made about the sonatas when compared with those single organ-mass movements of the French classical organists that appear on the surface to have similar trio-techniques behind them.
These are not church organ pieces, and the service provided no opportunity for such music. Ever since Forkel’s biography of Bach (1802), it has been accepted that these sonatas were in some way connected with the organ practice of his eldest and beloved son, Wilhelm Friedemann (born in 1710), either gradually compiled and/or composed over the period in which he was learning the organ, or eventually collected in a form which the young musician could take with him as he set out on his musical career. The composer kept a copy for himself, however, and several of his pupils—most successfully Johann Ludwig Krebs—produced works of their own in this manner, though not usually in three complete movements. Wilhelm Friedemann was not the only Bach pupil to have had both his organ-playing and his composing skills sharpened on some or all of these sonatas, and it is not difficult to imagine that they have definite pedagogic-didactic quality. Now, unfortunately, we usually only learn to play them, not to write invertible counterpoint modelled on their faultless technique.
As with other works of Bach that were at least in part useful for both the learner and the accomplished player, no didactic plan actually shapes the sonatas. They do not go from easy to difficult or sacrifice their artistic character in order to concentrate on specifics in the pupil’s wished-for progress.
The ‘Great’ Fantasias, Preludes and Fugues
Supreme master of the fugue that he became, Bach did not win this mastery easily. The transformation from angular faceless subjects and paragraphs that cadence too frequently, to the seamless everdeveloping textures made from characterfully-shaped melodic subjects achieved by observation, experience, and applied intellectual power, is as astonishing as the variety of the fugue subjects themselves. Indeed, German writers divide Bach’s developing fugal style into four main types: the Spielfuge, the dance fugue, the allabreve, and the art fugue.
The first, in which purely instrumental shapes and fragments are disciplined into relatively loose fugal structures, where the virtuoso element is strong and there is considerable reliance on lengthy episodes, is represented here by BWV532, 541, 542 and 548. The dance fugue finds the subject characteristically rhythmical (BWV536, 543) but shares also the purely instrumental devices of the Spielfuge, especially sequence both rhythmic and figurative. With the allabreve fugue we see an altogether more serious intellectual intent; the nature of the smoother, more vocally-orientated subjects admits a regular use of up to five parts (often with two subjects), a wider harmonic palette derived from the greater use of suspensions, and closer-knit episodes, as we see here in BWV534, 537, 545 and 546. The final category, the art fugue, achieves the zenith of contrapuntal strictness and ingenuity in which, in the words of Marpurg, ‘nothing other than the theme is elaborated—all the remaining counterpoint and interludes are drawn from the theme or counter theme.’ Bach’s Art of Fugue abounds in this style and in the organ music here we find a particularly magnificent example in BWV547. Other fugues, of course, may be seen to combine elements of more than one of these types, and the masterly synthesis of styles achieved with the approach of maturity is clear in BWV544 and 552.
The prelude, too, whether based on the many-sectioned rhetoric of the north, the sequential figuration of the south, or powerful five-part writing from France, became a personal synthesis of styles within a greatly increased spectrum of different formal devices, and, in the end, the prelude and its fugue were written for, and entirely complementary to, each other, which was by no means the case as Bach developed his handling of the form, revising either prelude or fugue, adding new preludes to old fugues, and the like.
What, then, did Bach write these works for, and what did he expect them to sound like? While the present-day notion of organ music before and after a church service was not as widespread in eighteenthcentury Germany, there is some evidence of a rather limited tradition (Scheibe of Hamburg mentions it in 1745), though not necessarily in those parts of Germany where Bach was active. Mattheson seems to imply one in 1739 (but in a book published in, again, Hamburg): ‘As for fugue playing, there are two types. The first type of theme … comes from the chorale melody itself. The second type concerns the prelude or postlude, in which the fugue acts as either a part or an ending.’ It is quite possible that Bach did not regard his preludes and fugues as having any part in the music he was daily preparing for service use because, unlike the chorale preludes and cantatas, he left no organized groups or collections of them.
Nonetheless, there was a widespread tradition of organ (or other instrumental or vocal) music after Saturday Vespers, besides, in Bach’s case, the occasions on which he gave recitals as part of his proving of a new organ, or on demand at either public recitals (of which six are documented between 1720 and 1747) or private gatherings. Certainly, although he held no official position as organist after leaving Weimar in 1717, Bach maintained an active interest in the prelude (or fantasia) and fugue form, not only composing new examples in Leipzig, but revising and retouching old ones there.
As to sound, the existing descriptions of Bach’s own playing outside the environment of a service suggest that he began invariably with a prelude and fugue for loud organ. Indeed, of the thirteen preludes and fugues presented here, eight indicate ‘organo pleno’ in one or other of their sources. This, however, is not as helpful as it sounds, for unlike the French grand jeu and petit jeu, the German pleno is nowhere codified precisely, and, if it were, Bach’s individual treatment of the organ’s tonal palette would lead us to think it mistaken to follow the norm, given C P E Bach’s description of his playing: ‘No one understood so well as he the art of registration. Often organists were terrified when he wished to play on their organs and drew the stops in his manner, since they believed it could not possibly sound well in the way he wanted; but little by little they heard an effect that amazed them. These sciences died with him’. Clearly a variety of imaginative and even unconventional colour is required, but whether this is achieved by changing manuals is another difficult question. Certainly Bach expected changes of manual sometimes. He asks for them in the Prelude BWV552 and the two strongly contrasted ideas in the Fantasia BWV542 invite them, but there are many instances, especially in the closer-wrought fugues, where it seems possible to travel to a secondary manual only to find no musical moment at which it is digitally possible to return. Again, Bach often achieves a change of colour by altering the density of the texture or character of the writing in such a way as to admit, in addition, changes in the type of articulation that can be employed. Colour, then, in whichever of the many ways it could be achieved, is central to a Bachian performance of these multi-faceted large works, but how this is achieved is, as is so often the case in Bach, ultimately left to the player’s resource.
The Toccatas and Passacaglia
The present works may all be said to stand apart from the types of music for organ associated with use in a liturgical context. Bach’s list of instructions for the service order in Leipzig in 1723, and other contemporary documents, show the organist, as would be expected, introducing (or ‘preluding’ before) the chorales, and playing further ‘preludes’ in alternation with the sung verses. Other opportunities for solo organ playing were as introductions to the choral parts of the service—motets and cantatas—the purpose of this last being picturesquely described by Mattheson in 1720 as to fix the ensuing pitch in the minds of the singers, and to allow the players, under the cover of the organ sound, to tune their instruments. There is less precise reference to the possibility (regular or occasional) of organ music opening and closing the three and a half to four hours which made up the main Leipzig service during Bach’s cantorship.
We can see here, then, a regular use of more than one chorale prelude in each such service, and a less clearly regular opportunity for extended preludes and fugues (played either separately or together). While Bach transcended and expanded everything that he touched, we should remember that he himself had fallen foul of the Arnstadt authorities in 1706 for making his accompaniments to chorales too complicated for the congregation to follow and that, in the previous year at Leipzig (eighteen years before Bach’s appointment there) there were warnings against the organ prelude before the Communion becoming too long. It is unlikely, therefore, that such flamboyant, extended, and technically demanding works as the four Toccatas and the Passacaglia would have found an easy place in such an austere liturgical context. However, by 1745, five years before Bach’s death, fashions may have been changing, for Scheibe in his Der Critische Musikus describes the organist’s opportunity, and ample time, to show off his abilities both before and after the service.
For what purpose, then, were these pieces written? Given that Buxtehude’s evening concerts (or Abendmusiken) in Lübeck, to which Bach journeyed to learn in the winter of 1705/6, were the exception rather than the rule, the only occasions when an organist was officially required to perform in concert conditions were as a candidate in competition for an appointment or at the testing and opening of a new instrument; certainly the ‘Dorian’ Toccata and Fugue in D minor, BWV538, was used by Bach in the latter capacity in September 1732 at Cassel, and as early as 1703 (when he was eighteen) he combined both activities with success at Arnstadt by ‘examining’ the organ with such proficiency that he himself was appointed the new organist. Throughout his life, Bach was in regular demand as the examiner of new instruments, and it was in large measure through this activity that his fame as a virtuoso player with an original and piquant command of registration spread. What better music could Bach have designed for such purposes than these many-sectioned pieces with their ample opportunity for display—pedal solos, manual dexterity, textural variety, contrapuntal virtuosity, as well as exploration of an instruments potential—emphasis on departments both individually and in tandem, opportunities for frequent registrational changes, from blend-searching light combinations to a densely-textured pleno to challenge any wind supply. In this connection, it should be remembered that in the Germany of Bach’s time (and also today) it was accepted practice to employ a registrant to assist in varying the tonal spectrum, and this tradition has been followed in the present recording.
Within this small group of works it is easy to see the extent to which Bach assimulated, enriched, and synthesised the formal antecedents and national styles which fell under his gaze. North German methods were culled early, from his friendship with Böhm at Lüneburg and from Reincken in Hamburg (1700-2), and Buxtehude (1705/6), while the proximity of Celle to Lüneburg introduced him to the French music in favour there, an interest sustained by Bach into his Weimar years where he copied de Grigny’s organ works, and the Applicatio, BWV994, reproduces ornaments after d’Anglebert. In youth Bach had copied extensively the South German repertory of Froberger, Kerll, and Pachelbel, while, apart from the copy of Frescobaldi’s Fiori Musicali (1635) which he had signed in 1714, the cultivation of the Italian concerto at the Weimar court was especially catalytic.
Organ Miniatures
In his biographical essay on Bach published in 1802 Nikolaus Forkel divides the organ works into three categories: Grand Preludes and Fugues (twelve in all, including those in E minor (BWV533), G minor (BWV535) and D minor (BWV539) which appear in this collection) plus the Passacaglia; works based on chorale melodies requiring obbligato pedals, of which he had discovered some seventy examples; and the six Trio Sonatas and a few additional works of similar type—of interest, but not quite up to the standard of the rest. He dismisses everything else, of which he says there are a great number of examples scattered about in the world, as mere gropings towards the perfection of Bach’s mature style, and in the process gives a rather lopsided and romantic view of the composer springing to life ‘fully formed’.
Owing to the paucity of autograph material it is very difficult to date the majority of Bach’s organ works with any certainty, but the bulk of the pieces on this and the next disc probably belong to the pre-Weimar years when he was organist first at Arnstadt and then Mühlhausen.We see the young composer assimilating and synthesizing elements from the North and South German organ styles as represented on the one hand by Buxtehude and on the other by Pachelbel, together with coloristic and formal elements from the French keyboard composers. Christopher Herrick, in this collection of ‘miniatures’, has gathered together many of these apprentice works to provide a fascinating portrait of a composer learning his craft, as well as others from his times at Weimar, Cöthen and Leipzig, thus spanning his entire creative life. The term ‘miniature’ is not meant in any way to be a reflection on their scale or ambition—indeed several are large conceptions.
Writing in 1760, Friedrich Wilhelm Marpurg said: ‘Bach … shook all sorts of paper intricacies out of his sleeve, any one of which would make a man sweat for days.’ These discs take us on a fascinating journey, tracing the development of Bach’s art and most particularly his mastery of fugal writing. It is a journey full of riches and shows that the ‘paper intricacies’ were always used in the service of musical expression and that the achievement is anything but ‘miniature’.
The Italian Connection
Many obstacles confront the researcher of Bach’s transcriptions for organ. The problems relate to authenticity both of text, in certain instances, and of attribution, in the same and other cases. They arise also from unresolved debate as to the actual purpose – assuming the work to be Bach’s – of the transcriptions in the first place. To add to all this, the Second World War and its aftermath entailed dispersal of much crucial source material in chaotic circumstances which may be readily imagined. The contemporary commentator’s wisest course is thus to present what little is certain and to invite others to draw their own conclusions.
Of the composers here represented, the least known exercised the most direct influence on Bach, though in a particular fashion. This was Prince Johann Ernst von Sachsen-Weimar (1696-1715), nephew of Duke Wilhelm Ernst, Bach’s employer from 1708 until 1717. Prince Johann, an assiduous student musician, sent copious consignments of Italian scores home to Weimar while attending the University of Utrecht between February 1711 and July 1713 (at a remarkably tender age by present-day standards). After his return he received tuition as a composer from Johann Gottfried Walther (1684-1748), an almost exact contemporary of Bach. (Walther’s own transcriptions, by his testimony, numbered seventyeight, provoking speculation of overt rivalry. However, only fourteen are known to survive and it is thought that many post-dated Bach’s presence at Weimar.)
As regards Bach’s transcriptions, the bone of contention is whether they were undertaken for purposes of self-instruction or with an eye to providing concert repertoire for Weimar, perhaps even in the form of commissions by Prince Johann. The latter view, expressed within the past twenty years by Hans- Joachim Schulze, accords with received knowledge of the general status quo at Weimar, but has been questioned on more specific grounds by Peter Williams in his formidable study, The Organ Music of J S Bach (Cambridge, 1980). The former opinion, propounded in print by Bach’s biographer Forkel as long ago as 1802, has been contested partly on grounds of that author’s willingness to conjecture what Bach could have been seeking in the way of technical enlightenment, and also because the modest talents of Ernst hardly make his work an obvious hunting ground, unless flattery came into it as well. Yet another layer of confusion descends when we consider Vivaldi, to whom the same arguments do not apply. Even the possibility that Ernst and Vivaldi were transcribed for wholly separate reasons cannot be definitely ruled out.
Despite the above, one should emphasize that the stumbling-block to Forkel’s theory is Ernst’s modest attainment rather than Bach’s greatness. Belated posterity has lent Bach a near-divinity which easily deludes us into rejecting any notion of youthful development, any acknowledgement of a time when he knew less than everything; and this ironically does less than justice to his scholarly appetites and his capacity to feed burgeoning genius on elements of received tradition. In the case of Vivaldi, Bach undoubtedly recognized that he could learn much, and did so. We should bear in mind that in 1713 he was a young man of twenty-eight.
The American scholar David Schulenberg points to the ‘assimilation of the Venetian concerto style into Bach’s work in other genres’ (The Keyboard Music of J S Bach; Gollancz, London, 1993). This, he considers, had begun by 1713. Schweitzer goes so far as to proclaim that Bach ‘won his freedom from Buxtehude by means of the Italians’, and that study of Legrenzi, Corelli and Vivaldi taught him what Buxtehude and Froberger could not: ‘clearness [sic] and plasticity of musical structure’ (J S Bach, translated from French by Ernest Newman; Breitkopf and Härtel, London, 1911). Behind this sweeping announcement lies more than a hint of truth. Before 1717 Bach was demonstrably favouring quasi- Italian ritornello procedures in sacred cantatas, a phenomenon which may be observed also in certain preludes and fugues and in a particular ‘distinctive type of embellished adagio’ (Schulenberg). Schulenberg dates mature handling of this stylistic extension from around 1714, justly including movements from Bach’s concerto transcriptions.
Bach is thought to have made approximately twenty concerto arrangements. In three cases the original composers are unknown. Five arrangements are for organ with independent pedal parts, two existing in alternative versions both with pedals (‘pedaliter’) and without (‘manualiter’). The remainder are assumed to be intended for harpsichord. Questions as to authenticity arguably persist, owing to the scattering of documentary sources, and Williams emphasizes that the transcriptions are in no sense an integrated group. No ‘album copy’ exists, nor a complete Autograph manuscript. Despite Walther’s continued activity in the same sphere, the cessation of Bach’s transcribing activity has been widely attributed to the very early death of Prince Johann Ernst after a year’s illness or more. The deduction that demand had thus ended naturally favours Schulze’s argument and further undermines that of Forkel.
As has been shown, the puzzles and questions attending this corpus of works are legion, even when one ignores for the moment the imponderables arising from registration. (On this subject, the reader is referred to Peter Williams’s monumental three-volume study.) These transcriptions, however, are of value in perpetuating the rather forlorn figure of Prince Johann Ernst. More importantly, they present both organist and listener with a rich counterpart to Bach’s corpus of wholly original organ compositions (many of those contemporaneous with the transcriptions) and offer illuminating signs of Bach’s variable priorities. We should remember that he came to the task with professional service as a violinist behind him, and that as often as he created idiomatic new organ music he might also have wished to preserve the listener’s apprehension of underlying string sonority.
Perhaps a glimpse one generation or so further back can provide us with a guiding image: it is known (from Mattheson’s Ehrenpforte, 1740) that the organist Nicolaus Bruhns (1665-1691) had on occasion seized his violin during a voluntary and accompanied his no less formidable string virtuosity on the pedals. This attractive picture can serve us well in illuminating the even-handedness – in every sense – of Bach’s concerns as an arranger, even if his precise reasons for undertaking these transcriptions in the first place may never be established beyond all doubt.
Organ Cornucopia
This ‘horn of plenty’ contains a host of shorter pieces, some of which are incomplete and some whose attribution to Bach is in question. Unfortunately this cannot be the place for a detailed discussion of the acceptance or rejection of Bach’s authorship of these works: the enormous flowering of Bach scholarship, particularly since the Second World War, has seen a gradual drawing up of battle lines between opposing scholastic factions, leading to some very hot-headed debate. In the absence of hard evidence, scholars have to resort to quasi-scientific analysis; by comparing stylistic features in the doubtful works with those whose provenance is not in question, they hope to show that Bach couldn’t have been the composer of pieces which contain lapses of technique or invention. Of course this approach can ultimately only be subjective. We know little about Bach’s training as a composer and it surely does him no disservice to accept that he could have written music which does not achieve the standard of perfection of the rest of his output. However, we should lay aside questions of authorship for the moment and simply enjoy a succession of little gems which provide pleasure for listener and performer alike.
The Orgelbüchlein
The chorale—sacred song or hymn—dominated the activities of the Protestant German organist before, during and after Bach’s time. The melodies and words, often barely altered since Martin Luther and the Reformation two hundred years earlier, were closely associated and only occasionally did one tune serve more than one set of words. Together they came to reflect the general symbols of the relevant season or sentiment; they were the very fabric of the liturgical music which organists provided and in which congregations participated.
Performance practice was notably different from what we take for granted today. First, the chorales were, when sung, performed not only in unison and unaccompanied, but also immensely slowly, though Dr Burney’s remark during his ‘musical tour’ of Germany in 1772—that he entered a church during the singing of a chorale, left, and returned two hours later to hear the same chorale being sung—needs to be taken in the knowledge that it was customary to ‘feature’ a single chorale text and its tune throughout a single service (hence Bach’s own practice of treating the same chorale in a variety of ways during the course of a single cantata) and that, given the very large number of verses in a typical chorale text, different portions of it were sung to the same tune at different points in the service. The main service on Sunday (the Hauptgottesdienst at which Bach would have seen his weekly cantata performed) lasted a full five hours, from seven in the morning until midday.
Secondly, when the organ was used in the accompaniment of chorales, it could participate in a number of ways, though even today we are uncertain about how many of the options were used regularly in any one place or the extent to which local conditions dictated the number and kind of practices. The orders of service which have come down to us (at least from the first half of the eighteenth century) tend to detail unusual or special occasions rather than standard routine. Suffice it to say that the organ’s connection with the performance of chorales could be in any of four areas. First, it could accompany the singing by providing the harmony, and probably interludes made up of extempore flourishes between verses, or even lines of verses, in a manner simple enough to ensure that the harmony was not so sophisticated, or the interludes so brilliant and unexpected, that the congregation would collapse into confusion (as did once happen under the young Bach at Arnstadt, an occurrence for which he received a strong reprimand from the church council). Secondly, it could provide, besides accompaniment for the sung verses, longer and more formally worked-out interludes between the verses (chorale partitas, or sets of variations, may well have been used in this way, as well as in their documented domain as recital pieces). Thirdly, it could introduce the chorale by means of simple or sophisticated organ treatment of the melody which would be so well known that it would remain recognizable even in the most densely textured setting. Lastly, the organ could evoke the sentiment or mood of a text by appropriate musical treatment of the tune connected with it before the central point of the service—the sermon.
There is mention of organ chorale preludes being used for this purpose, before the performance of the cantata within the service, but also—surprisingly—for the added purpose of providing the pitch for, and covering the noise of, the instruments tuning in preparation to accompany the cantata itself. The ‘modern’ uses for the chorale prelude—at the beginning and end of a service—would not have occurred to organists of that time. The chorale prelude was, above all, intended to illuminate the liturgy from within. However, we know that music based on chorales did contribute to other more secular activities. Such music would be played during the public trial that was customary before the appointment of a new organist, when much store would be laid by the candidate’s ability to treat a chorale melody in a variety of ways extempore; during the proving of a new organ (Bach himself evolved a planned juxtaposition of preludial, fugal and chorale-based compositions for his own use on such occasions); and it could be played on the relatively few occasions when recitals were given and extempore treatment of a chorale formed part of the programme (possibly the greatest example of this, Bach’s half-hour-long exposition on An Wasserflüssen Babylon in front of Reincken in 1720, was never written down).
The Schübler Chorales
In the last years of his life Bach published examples of work which were effectively a form of musical legacy. They represented the summation of his art. The Schübler Chorales are so called because the engraving and publication was arranged by Georg Schübler, one of Bach’s pupils. They represent one of only two volumes of Bach’s organ music published in his lifetime and they have a liturgical scheme, being in the sequence of the church year and the preparation for Advent, and based on the progress of the Christian life from the cradle of Christian awareness to the grave and beyond.
Five of the chorales are related to movements from his church cantatas, dating from 1724/5 and 1731, written for liturgical performance at the Thomaskirche in Leipzig, where he became Kantor in 1723. It seems likely that the cantata movements were composed first, then adapted for the organ. The overwhelming trend in Bach’s transcriptions was to reduce works for larger forces to keyboard pieces. The obbligato in the fifth Schübler prelude exploits ‘cross-string’ writing, suggesting strongly that it was transcribed for the keyboard from the cantata version. Similarly the fourth prelude has a certain bleakness because it lacks a continuo, as is the case with the slow movements of the first two ‘organ’ concertos.
The set is no random collection, but provides a rich feast for those who hunt for symbolism in Bach’s music, not least because the musical letters BACH appear at the half-way point (BWV648, bars 7 and 8). Various numerical combinations can be made to add up to the name BACH, and the assignment of the cantus firmus to a particular voice in each prelude may also have symbolic importance, as indeed may the key relationships between the preludes. Numerical symbolism also strongly suggests the Trinity. For example, each piece is in three voices, and the first of the set is in E flat major, Bach’s ‘Trinity’ key.
The Leipzig Chorales (The eighteen)
This is another collection of chorale preludes from Bach’s last years. They have come down to us in a largely autograph manuscript which also includes the organ sonatas and the Canonic Variations on Vom Himmel hoch. It is another volume in Bach’s musical legacy and consists of preludes composed according to several different techniques. They were probably written during the time he spent at Weimar where he had become Court Organist in 1708, the year after his marriage to Maria Barbara. The young Duke of Weimar lived a life of religious fervour and devotion, and expected the same of those in his employ. There would seem to have been an empathy between Bach and the Duke, and Bach’s request for an extensive reconstruction of the organ was favourably received. Thus the composer found himself in a place which was both spiritually right for his development as a writer of liturgical music for the organ, and which also had the facilities.
The preludes pick up various threads of German organ style which Bach had inherited from Böhm and Buxtehude in the north and Pachelbel in the south. They set and incorporate the chorale melodies in various ways, but these are invariably played complete in one voice through the course of each composition as a cantus firmus, either plain or elaborated. In some of the preludes the main constructional elements of the music are themselves derived from the notes of the chorale.
Bach revised many of these preludes when he was in Leipzig, hence the title they are given here. There is an unfinished element in this set of preludes which do not appear to have any particular logic or liturgical considerations behind their order. The eighteenth chorale of the set, Vor deinen Thron, is incomplete, and in another hand, so there is no certainty that it was part of Bach’s conception for the collection.
The Kirnberger Chorales
Johann Philipp Kirnberger was a composer and theorist who came to Bach in Leipzig as a pupil about a decade before Bach’s death. He later idolized Bach for his contributions to music, and in his theoretical writing tried to expound what Bach might have done if he had written treatises himself. But as the great collections from Bach’s last years show, he left his theories to posterity not in words but in music. Fortunately for us, Kirnberger was in some way responsible for assembling the collection of chorale preludes named after him, spending some fourteen years of the latter part of his life in Berlin compiling Bach’s works for Princess Anna Amalia of Prussia. The collection may not have the consistency of those compiled by the composer himself, but it provides a rich treasury of preludes in varied sizes and styles.
The chorales are in manuscripts probably compiled under Kirnberger’s direction, but not in his hand. They do not form a coherent volume in the way that the Orgelbüchlein does, and their dates are unknown. However, there seems to be some sense of order in relation to the Advent and Christmas chorales, and the similarity of the fughettas suggests that they form a set. The fughettas begin the following sequence. Each one is brief, in three or four voices, and written on two staves, although the pedal is used sparingly in these performances to bring out the chorales.
The Clavierübung and other ‘Great’ Chorales
In the event Johann Elias Bach, who was acting as the composer’s secretary, was somewhat optimistic in his prediction and the handsomely produced Third Part of the Clavierübung did not appear until Michaelmas (29 September), at a price of three thalers. This was a not inconsiderable sum in 1739 and it is little wonder that even music which had been engraved and printed still continued to circulate in manuscript as well. The volume differed considerably from its two predecessors both in content and intention. Part One, which appeared in 1731, brought together the six Partitas which Bach had published singly between 1726 and 1730. The Second Part comprised two works: the ‘Italian Concerto’ and the French Overture. The instrument required was the harpsichord (a two-manual instrument in the case of Part Two), making this music primarily for domestic consumption, although a virtuoso technique was called for. Thus the composer would have ensured a wide circulation in a specific market. The contents of the Third Part are much more wide-ranging and, as they are designed for a variety of instruments, it is less easy to apprehend at whom they were aimed.
The collection consists of twenty-one chorale preludes, each melody appearing in two highly contrasted settings. One is a large-scale composition requiring an instrument with two manuals and pedals while the other is for manuals only and generally much shorter. The one exception to this plan is Allein Gott in der Höh sei Her which appears three times. Certain features of the keyboard writing in the shorter settings suggest that they could be for harpsichord equally as well as for organ. There are also Four Duets (recorded on Disc 5 in this set) which, while not straying outside the range of the organ keyboard, are stylistically much closer to the two- and three-part Inventions and therefore also equally suited to performance on the harpsichord or clavichord. The whole collection is framed by the mighty Prelude and Fugue in E flat, the only such pairing to be published in the composer’s lifetime.
The Partitas and Canonic Variations
To any organist in Protestant Europe in the late seventeenth and early eighteenth centuries, the chorale would have been at the centre of his activities, and for Bach, as well as for any other composer-organist of this period, the many established ways of incorporating and developing chorale-based material would have been a life-long occupation. For Bach also, the great synthesizer of national styles, textural symbolism and numerological mysticism, the imaginative expansion of the technical and musical possibilities inherent in the chorale melodies which he set was to become an absorbing passion. That the organ chorale partita, or suite of pieces each based on and varying the same chorale melody, formed the smallest segment of all the types of chorale treatment in his output, is partly to do with his development as a composer and partly a matter of practical circumstance.
It is clear that Bach’s increasingly concentrated exploration of mood and motive directed his attention more towards a single all-encompassingly complete setting of the chorale in hand (though he often returned to the same melody at a later date to compose a new setting from a different viewpoint), rather than a string of less objectively intense variations each necessarily below his achievable potential in a single setting. The two rather differently constructed and through-composed settings of Christ ist erstanden (BWV627) and O Lamm Gottes, unschuldig (BWV656) are possible exceptions, but it is clear that Bach lost interest in the pure chorale partita form relatively early in his career and turned to it again only in rather special circumstances in the very last years of his life. Certainly the opportunities for the performance of such fully worked, and written out, pieces in the genre diminished as the eighteenth century advanced.
The origins of the chorale partita are found in the concert variations on chorale melodies by Sweelinck one hundred years earlier. Themselves based on the variation techniques of the English Elizabethan virginalists, through Sweelinck’s friendship with John Bull, the style was introduced to North Germany by Sweelinck’s pupils Scheidt and Scheidemann. Their achievements were built on and developed by Buxtehude, Reinken and Böhm in the North, and Pachelbel (who also absorbed stylistic influences from Italy) further South. Sweelinck’s examples were for concert use, for the strict Calvinist views in the Netherlands of his time precluded such secular virtuosity in a sacred context. However, in Germany the chorale partita soon came into its own in two particular ways.
The old pre-Reformation custom of alternating sung plainsong and organ versets (themselves based on the same chant) was taken over in the practice of the organ introducing and alternating with the verses of the chorale as sung (very slowly to our ears) by the congregation. In the interludes between the verses, the organ chorale variation settings transcended their purely practical function (of allowing the congregation to regain their breath), by reflecting or anticipating the mood of the sung text. In practice, even given the extraordinary length of German Protestant services, the carefully composed and writtenout organ variations came to be viewed as too long or, as compositional techniques advanced, disturbingly complicated, and improvised interludes to suit the exact nature of circumstances became a more flexible and accepted norm.
The chorale variation technique, both written out and improvised, was further encouraged both by the customary yearly recital by the organist to his congregation in demonstration of his continuing and developing powers of execution, and the occasion of a candidate’s trial in competition for a new post, at which he was expected to improvise on a given chorale in all the accepted styles of treatment. Indeed, perhaps Bach’s greatest achievement in this genre was never written down.
The Neumeister Chorales
While most of us dream of winning the lottery it is surely the life’s ambition of every musicologist to discover an unknown manuscript by a major composer. The sense of fulfilment must be all the greater when the discovery fills a glaring gap in our knowledge of the composer in question. An original manuscript source for a Bach organ work, known or unknown, would of course be a rare find indeed, given the paucity of such autograph material, but what Professor Christoph Wolff and Yale music librarian Harold E Samuel found in the John Herrick Jackson Music Library at Yale University was the next best thing. This collection is a vast repository of source materials for the seventeenth and eighteenth centuries and in the course of examining a manuscript anthology of chorale preludes, compiled by Johann Gottfried Neumeister in the last decade of the eighteenth century, they identified over thirty previously unknown chorale preludes dating from Johann Sebastian Bach’s formative years. (Given that much of this collection is still to be explored in detail, who knows what other treasures are still to be revealed.) Of course, the attribution of non-autograph works is a speculative business and there are those who prefer not to allow that anything less than perfection could have flowed from Bach’s pen, at whatever stage of his development. However, the inclusion of seven pieces known from other sources gave Wolff and Samuel the confidence to make their conclusions known, and to prepare the pieces for publication in 1985.
Neumeister was a teacher and part-time organist, and the emphasis in this collection on relatively simple pieces, most of which can be played without pedals, is presumably a reflection of the modesty of his abilities on the instrument. The manuscript is laid out in much the same way as the Orgelbüchlein—that is, a comprehensive series of settings for the Church year. It is open to speculation whether Neumeister was copying from an existing anthology, or whether he made his own selections from various sources, taking his cue from Johann Sebastian’s work. Whichever, it is interesting to note that 22 of the present chorales were listed but not set in the Orgelbüchlein and they include several which do not appear anywhere else among Bach’s chorale-based works. At some point the volume passed into the hands of Christian Heinrich Rinck who had studied with one of Bach’s last pupils, J C Kittel; he was a keen collector of Bach memorabilia and did much to keep his tradition alive.
In all, seven composers are represented among the collection’s 82 chorale preludes with by far the most significant contributions coming from two generations of the Bach family. In addition to the 38 chorales by Johann Sebastian there are also 25 by Johann Michael Bach, a first cousin of his father Ambrosius, whose vocal music he was still performing during his time at Leipzig. (Johann Michael’s daughter Maria Barbara was Bach’s first wife.) The other composers represented are Johann Christoph Bach (another cousin), Zachow, Pachelbel, Erich and Sorge.
Bach Attributions
All of the music on this disc has at one time or another been attributed to J S Bach but is now generally thought to be the work of others. However, in only a few cases has it been possible to identify positively the actual composer. The fact that until well into the latter part of the eighteenth century most music was transmitted in manuscript is sufficient explanation in itself for the widespread confusion over authorship of works from this period. One only has to think how many members of the Bach family were writing music at this time to see how the slightest confusion over the forename on a piece could be magnified every time the work was copied. As always, the lack of autograph material for much of Bach’s organ music makes identification of disputed pieces difficult. Many of the present pieces have come down to us in manuscript collections which also contain works which are verifiably the work of Johann Sebastian; this means that much of the work of attribution has necessarily to be based on stylistic comparison and, ultimately, conjecture. The arguments against accepting many of these pieces into the canon are essentially negative ones, based on the fact that they display characteristics and a level of technique which are not discernible elsewhere in Bach’s output. While such theses can be quite persuasive, in the absence of any positive identification they must remain, for the moment, speculative.
The principle source for the Eight ‘Little’ Preludes and Fugues—in fact the only one of any significance—is a collection dating from the second half of the eighteenth century, which may have emanated from the Bach circle. Another copy, now lost, belonged at one time to Bach’s biographer, Forkel. This lack of sources is one of the major stumbling-blocks for scholars who do not believe in Johann Sebastian’sauthorship; surely, if he were the composer there would have been many more copies in circulation. Equally perplexing for commentators is the gulf between the quality of the ideas and their working-out. The motifs are generally quite striking, well defined and characterful, but there are moments of harmonic infelicity and clumsy part-writing. In his ground-breaking biography of the composer, Philipp Spitta wrote that they ‘bear the stamp of a commanding master of composition’ and were therefore not the product of his musical youth. More recently the scholar and editor Alfred Dürr has asserted that ‘it can be presumed’ that Bach did not write them. This is the most widely held view, though not universally so, among Bach scholars today. While some people are still prepared to admit the possibility that they are, at least in part, apprentice works of Bach, others will not even entertain the idea.
Although they have come down to us as a collection, in view of the widely diverging stylistic influences they display—some of which Bach could not have known when his technique was still as unformed as here—perhaps they should not be regarded as an integral set at all, but instead simply as a group of pieces which were gathered together over many years as convenient teaching material. Perhaps Bach could have been involved to varying degrees in their composition. It could be that he did indeed write some of them, while others possibly originated as composition exercises set for his pupils—ideas jotted down to stimulate their imaginations and act as a spur to their creative efforts. The only thing that is clear is that until more source material becomes available they will continue to generate lively debate.
However, even if the music does turn out to be the work of others, should that change our perception of it? Just as the sensuously entwining voices of Nero and Poppea in the final duet of Monteverdi’s L’incoronazione di Poppea still weave their magic, even though we now believe it to be the work of one Benedetto Ferrari, so the geniality and grace of the Eight Little Preludes and Fugues, which have provided an introduction to the organ works of Bach for generations of aspiring organists, remain undimmed.
Hyperion Records Ltd ©
Die sechs Sonaten BWV525-530 sind einzigartig. Neuere Untersuchungen der Quellen, insbesondere John Butts Artikel in The Organ Yearbook Nr. 19, bestätigen verschiedene Annahmen: dass die letzte Sonate (BWV530) wahrscheinlich unabhängig von den anderen Stücken von Grund auf als Orgelsonate komponiert wurde und möglicherweise das früheste der einschlägigen Werke war; dass andere einen oder mehrere Sätze enthalten, die aus ihrer Originalfassung für Orgel transkribiert wurden, obwohl es sein kann, dass nicht so viele der Sätze Transkriptionen sind, wie man früher annahm; dass Abfolge und Anzahl vor der endgültigen Zusammenstellung nicht festlagen und dass das erste Werk (BWV525) zu den anderen hinzugefügt worden sein könnte und vielleicht als Nr. 5 vorgesehen war. Diese und andere Mutmaßungen über das Exemplar des Komponisten, an dem in gewissem Maße noch während seiner Erstellung gearbeitet wurde (mit anderen Worten: es gibt keine eindeutige Reinschrift), lassen den Schluss zu, dass die Zusammenstellung trotz ihrer scheinbar klaren Konzeption für Bach ein eher experimentelles Vorhaben war und manche Aspekte, speziell der Titel und die Abfolge, neu überdacht worden wären, wenn er je dazu gekommen wäre, eine endgültige Reinschrift herzustellen. Wenn BWV525 z.B. an die vorletzte Stelle gerückt worden wäre, hätte der Tonartenplan größere Ähnlichkeit mit dem anderer Stücksammlungen im Oeuvre des Komponisten: c/d/e/C/Es/G ist beispielsweise vergleichbar mit der Reihenfolge B/c/a/D/G/e bei den Partiten der Clavier-Übung I.
Die Unsicherheit über Bachs Intentionen in dieser Hinsicht lassen dem heutigen Künstler einigen Spielraum bei der Einspielung. Christopher Herrick hat davon Gebrauch gemacht und für die vorliegende Aufnahme eine Stückfolge ausgearbeitet, die in Bezug auf Stimmung und Stil starke Kontraste aneinander reiht; an den Anfang und den Schluss stellt er darüber hinaus zwei der aufregendsten und extravertiertesten Sätze der Sammlung.
Musikalisch ist einigermaßen klar, welche Aufgabe Bach sich gestellt hat: eine Reihe von Orgelwerken zu schaffen, die den Kammersonaten in spezifischen italienischen bzw. italienisch inspirierten Gattungen entsprechen. Doch handelt es sich keineswegs um eine schlichte Angleichung. Erstens ähnelt der dreisätzige Plan von fünfen der Sonaten eher italienischen Concerti jener Zeit als Streichersonaten. Zweitens wird der Kontrapunkt der beiden Oberstimmen wesentlich rigoroser gehandhabt als in praktisch allen italienischen Triosonaten, selbst den von Händel komponierten, und lehnt sich enger an die umkehrbaren Texturen von Trios in Gestalt von Orgelchorälen an, wie sie von den meisten lutherischen Organisten verfasst wurden, die ihre Werke zu Papier brachten. Drittens findet hier nicht nur eine ‘Bereinigung’, sondern auch eine ‘Miniaturisierung’ der Genres italienischer Sonaten bzw. Konzerte statt; das vom Interpreten geforderte musikalische Können wirkt unverhältnismäßig im Vergleich zur Kürze und Prägnanz der Werke, Eigenschaften, die Bach eher bei Corelli als bei Vivaldi vorgefunden hätte. Ganz und gar italienisch sind hingegen die Feinheiten der Ritornellsätze und die beiden Abarten der zweiteiligen Form (langsamer Tanz als Mittelsatz, schnelles Finale). Die als Ritornell-Fuge ausgebildeten Finalsätze stellen eine ganz bewusste Nachahmung der idealen Fuge italienischer Kammermusik dar. Von ihrer Gestaltung und Melodik her ähneln die Stücke weder der ‘deutschen Orgelfuge’ noch der ‘kammermusikalischen Klavierfuge’, von denen Bach zu diesem Zeitpunkt bereits zahlreiche komponiert hatte (z.B. die großen Orgelfugen in C-Dur, D-Dur, g-Moll usw. sowie Teil I des Wohltemperierten Klaviers). Darüber hinaus haben die Sonaten, insofern sie italienisch beeinflusst sind, Ähnlichkeiten mit Streichmusik: Das Italienische und Streicher sind hier fast synonym, und ein Satz wie das Finale von BWV529 weist tatsächlich enge Verbindungen zu Bachs üblicher Umsetzung der Kontrapunktik italienischer Streichmusik auf. Doch das Endergebnis ist eine Serie von Stücken, die man niemals mit italienischer Kammermusik verwechseln könnte, ebenso wenig wie mit den Gattungen deutscher Orgelmusik (mit Ausnahme gewisser Choraltrios). Ähnliches ließe sich über die Sonaten im Vergleich zu jenen einzelnen Orgelmesssätzen von Organisten der französischen Klassik sagen, die auf den ersten Blick vergleichbare Triotechniken zur Grundlage zu haben scheinen.
Dies sind keine kirchlichen Orgelstücke, und der Gottesdienst bot keine Gelegenheit zur Darbietung solcher Musik. Seit Forkels Bach-Biographie von 1802 geht man allgemein davon aus, dass die Sonaten irgendwie mit der Orgelausbildung seines ältesten und geliebten Sohns Wilhelm Friedemann (geb. 1702) im Zusammenhang standen, für den sie entweder im Lauf der Zeit während seiner Orgelstudien zusammengestellt und/oder komponiert oder schließlich in eine Form gebracht wurden, in der der junge Instrumentalist sie beim Aufbruch in seine Musikerkarriere mitführen konnte. Der Komponist behielt jedoch ein Exemplar für sich selbst zurück, und mehrere seiner Schüler—am erfolgreichsten Johann Ludwig Krebs—schufen eigene Werke in dieser Manier, wenn auch meist nicht in drei vollständigen Sätzen. Wilhelm Friedemann war nicht der einzige Bach-Schüler, dessen Fähigkeiten im Orgelspiel ebenso wie im Tonsatz anhand einiger oder aller diese Sonaten geschärft wurden, und man kann sich unschwer vorstellen, dass sie bestimmte pädagogisch-didaktische Absichten haben. Heuntzutage lernen wir leider gewöhnlich nur, sie zu spielen, nicht umkehrbaren Kontrapunkt zu schreiben, der sich an ihrer makellosen Technik orientiert.
Wie bei anderen Werken Bachs, die zumindest teilweise sowohl dem Lernenden wie auch dem erfahrenen Interpreten dienlich sind, unterliegen die Sonaten nicht wirklich einem didaktischen Plan. Sie sind weder in der Reihenfolge von leichten zu schweren Stücken angeordnet, noch stellen sie ihren künstlerischen Wert hinter die Spezifika eines etwa gewünschten Lernfortschritts zurück.
Die ‘Grosse’ Fantasien, Präludien und Fugen
Bach, der zum überragenden Meister der Fuge wurde, ist nicht ohne Anstrengung zu dieser Meisterschaft gelangt. Die Wandlung von steifen, nichtssagenden Subjekten und Passagen, die allzu häufig kadenzieren, hin zu nahtlosen, sich stetig entfaltenden, aus reizvollen melodischen Subjekten aufgebauten Strukturen, die sich mit Hilfe von Beobachtung, Erfahrung und angewandtem Denken vollzogen hat, ist so erstaunlich wie die Vielfalt der Fugensubjekte selbst. Manche deutschen Autoren unterscheiden bei der Herausbildung des fugalen Stils von Bach zwischen vier Haupttypen: Spielfuge, Tanzfuge, Allabreve-Fuge und Kunstfuge.
Der erste Typus, bei dem rein instrumentale Formen und Fragmente in einen relativ lockeren fugalen Zusammenhang eingepaßt werden, dessen virtuoser Charakter ausgeprägt ist und der sich in erheblichem Maß auf ausgedehnte Episoden stützt, ist hier durch BWV532, 541, 542 und 548 vertreten. Die Tanzfuge zeichnet sich durch ein stark rhythmisches Subjekt aus (BWV536, 543), nutzt jedoch auch die rein instrumentalen Verfahren der Spielfuge, insbesondere das der rhythmischen und figurativen Sequenz. In der Allabreve-Fuge erkennen wir eine insgesamt ernsthaftere gedankliche Intention; ihre glatteren, eher vokal orientierten Subjekte ermöglichen den regelmäßigen Einsatz von bis zu fünf Stimmen (oft mit zwei Subjekten), eine breitere harmonische Palette, die sich aus dem vermehrten Gebrauch von Vorhalten ergibt, und kompaktere Episoden—hier veranschaulicht durch BWV534, 537, 545 und 546. Die letzte Kategorie, die der Kunstfuge, bezeichnet den Zenit kontrapunktischer Strenge und Genialität, an dem laut Marpurg nichts als das Thema verarbeitet wird und alle sonstigen Kontrapunkte und Interludien aus dem Thema oder Gegenthema hervorgehen. In Bachs Kunst der Fuge ist dieser Stil besonders häufig anzutreffen, und im Bereich der Orgelmusik finden wir ein besonders prachtvolles Beispiel in BWV547. Bei anderen Fugen läßt sich natürlich eine Kombination von Elementen aus mehr als einem dieser Typen feststellen, und die gekonnte Synthese der Stilrichtungen, die mit Beginn der Reifezeit erreicht wurde, wird an BWV544 und 552 deutlich.
Auch beim Präludium, das auf der stark gegliederten Rhetorik des Nordens, der sequentiellen Figuration des Südens oder der kraftvollen fünfstimmigen Kompositionsweise Frankreichs beruhen konnte, kam es zu einer persönlichen Synthese einzelner Stilrichtungen innerhalb eines erheblich vergrößerten Spektrums unterschiedlicher formaler Hilfsmittel. Zum Schluß wurden das Präludium und seine Fuge füreinander und in umfassender Ergänzung zueinander geschrieben—was keineswegs der Fall war, als Bach noch den Umgang mit der Form erprobte, als er entweder Präludium oder Fuge überarbeitete, neue Präludien an alte Fugen anfügte und dergleichen.
Und wofür hat Bach diese Werke geschrieben? Wie sollten sie seiner Erwartung nach klingen? Zwar war die heutige Gepflogenheit, vor und nach einem Gottesdienst Orgelmusik zu spielen, im 18. Jahrhundert in Deutschland nicht weit verbreitet, doch es finden sich Hinweise auf eine begrenzte Tradition (Scheibe, ehedem in Hamburg tätig, erwähnt sie 1745), wenn auch nicht unbedingt in den Regionen Deutschlands, in denen Bach gewirkt hat. Johann Mattheson berichtet 1739 (in einem wiederum in Hamburg erschienenen Buch), daß es zwei Arten des Fugenspiels gebe. Die erste entspringe thematisch der Choralmelodie, während die zweite das Vor- oder Nachspiel betreffe, in dem die Fuge entweder als Teil oder als Abschluß fungiert. Es ist durchaus möglich, daß Bach seine Präludien und Fugen nicht zu den Kompositionen rechnete, die er tagtäglich zum gottesdienstlichen Gebrauch schuf, denn er hat sie im Gegensatz zu den Choralpräludien und Kantaten nicht in geordneten Gruppen oder Zusammenstellungen hinterlassen. Immerhin war es üblich, nach der samstäglichen Vesper Orgelmusik (oder andere Instrumental- bzw. Vokalmusik) darzubieten, von den Gelegenheiten abgesehen, bei denen Bach sie im Rahmen der Erprobung einer neuen Orgel spielte, auf Verlangen bei öffentlichen Konzerten (von denen zwischen 1720 und 1747 zwanzig nachgewiesen sind) oder bei privaten Zusammenkünften. Obwohl er, nachdem er 1717 Weimar verlassen hatte, nicht mehr offiziell als Organist angestellt war, bewahrte sich Bach sein aktives Interesse an Präludium (oder Fantasie) und Fuge und komponierte in Leipzig nicht nur neue Werke dieser Gattung, sondern revidierte und überarbeitete dort auch alte.
Was den Klang angeht, so deuten die vorhandenen Beschreibungen der Spielweise Bachs außerhalb des Gottesdienstes darauf hin, daß er unweigerlich mit einem volltönenden Präludium und Fuge für Orgel begann. Auch von den vorliegenden dreizehn Präludien und Fugen tragen acht in der einen oder anderen Quelle die Bezeichnung ‘organo pleno’. Das ist jedoch weniger hilfreich, als es sich anhört, denn im Gegensatz zum französischen grand jeu und petit jeu ist die in Deutschland gebräuchliche Anweisung pleno nirgendwo präzise aufgeschlüsselt, und wenn sie es wäre, würde uns Bachs individueller Umgang mit der Tonpalette der Orgel veranlassen, ein Festhalten an der Norm für falsch zu halten. Beispielsweise sagt C Ph E Bach über das Spiel seines Vaters, er habe wie kein anderer die Kunst des Registrierens beherrscht: ‘Oft erschracken die Organisten, wenn er auf ihren Orgeln spielen wollte, u. nach seiner Art die Register anzog, indem sie glaubten es könnte unmöglich so, wie er wollte, gut klingen, hörten hernach aber—einen Effect, worüber sie erstaunten.’ Diese Kenntnisse habe J S Bach mit ins Grab genommen. Eindeutig ist, daß eine Vielzahl origineller, wenn nicht gar unkonventioneller Klangfarben verlangt wird. Ob diese allerdings durch Manualwechsel erzielt werden sollen, ist eine weitere heikle Frage. Mit Sicherheit erwartete Bach hin und wieder einen Wechsel der Manuale. Er verlangt ihn im Präludium BWV552, und die stark kontrastierenden Motive der Fantasie BWV542 laden dazu ein. Darüber hinaus aber gibt es zahlreiche Fälle, insbesondere in den stärker verdichteten Fugen, daß man die Möglichkeit für gegeben hält, auf ein Nebenmanual überzugreifen, nur um dann festzustellen, daß sich kein musikalischer Moment mehr ergibt, der den Händen die Rückkehr gestattet. Bach erzielt eine Änderung der Klangfarbe häufig durch eine dergestalte Änderung der Dichte der Struktur oder des Charakters der Stimmführung, daß außerdem Änderungen der angewandten Artikulationsform zulässig werden. Welche der vielen Methoden ihrer Erzeugung auch angewandt werden mag, in jedem Fall ist Klangfarbe somit von zentraler Bedeutung für eine Bach gerechte Aufführung dieser facettenreichen, großangelegten Werke. Wie sie jedoch erzeugt wird, bleibt wie sooft bei Bach dem Geschick des Interpreten überlassen.
Die Toccaten und Passacaglia
Die hier eingespielten Orgelwerke Bachs stehen abseits von der Art Orgelmusik, die ihren Gebrauch im liturgischen Zusammenhang findet. Bachs Liste von Anleitungen für den Gottesdienst in Leipzig, 1723, und auch andere zeitgenössische Dokumente deuten an, daß die Arbeit des Organisten erwartungsgemäss in der Einleitung (bzw. dem Vorspiel) zu Chorgesängen und in dem Einfügen weiterer Vorspiele abwechselnd mit dem Gesang, liegt. Andere Gelegenheiten zu solistischem Orgelspiel lagen in den Einleitungen zum Chorteil des Gottesdienstes, wie Motetten und Kantaten, deren Zweck zuletzt 1720 von Mattheson so beschrieben worden ist: sie dienen den Sängern dazu, sich die nachfolgende Harmonie einzuprägen und den Musikern dazu, ihre Instrumente, gedeckt vom Orgelklang, zu stimmen. Auf die Möglichkeit von Orgelmusik zum Ein- und Ausgang des 3.1/2 bis 4- stündigen Hauptgottesdienstes, der in Leipzig zu Bachs Zeiten als Kantorüblich war, sind nur weniger genaue Hinweise zu finden.
Wir können hier den stetigen Gebrauch von mehr als einem Chorvorspiel in jedem dieser Gottesdienste sehen, jedoch herrscht eher Unklarheit über die Gelegenheit zu regelmäßigen Aufführungen langatmiger Präludien und Fugen (getrennt oder zusammen gespielt). Bach wußte alles, womit er in Berührung kam, bis oder sogar über seine Grenzen hinausauszuschöpfen, aber wir sollten dabei nicht vergeßen, daß er selbst 1706 in die Ungunst der Authoritäten in Arnstadt geriet, da er die Begleitung der Chöre für die Gemeinde zur Nachvollziehung zu kompliziert machte, und dass in dem Jahr zuvor (18 Jahre vor Bachs Anstellung) in Leipzig Warnungen verlaut wurden, die Orgelvorspiele zur Hl. Kommunion nicht zu lange werden zu lassen. Es ist daher unwahrscheinlich, daß so glänzend ausgebaute und technisch anspruchsvolle Werke, wie die vier Toccaten und Passacaglien leicht ihre Stellung in solch einem strengen liturgischen Kontext finden würden. Wie auch immer, die Gebräuche schienen sich um 1745, fünf Jahre vor Bachs Tod, gendert zu haben, daß Scheibe in seinem Der kritische Musikus die häufigen Gelegenheiten des Organisten beschrieb, zu denen er seine Fähigkeiten sowohl vor als auch nach dem Gottesdienst beweisen konnte.
Zu welchem Zweck also wurden diese Stücke geschrieben? Buxtehudes ‘Abendmusiken’ in Lübeck, zu denen Bach, des Lernens wegen, im Winter des Jahres 1705-6 reiste, waren eher die Ausnahme als die Regel. Die einzigen Gelegenheiten, an denen von einem Organist erwartet wurde, in Form eines Konzertes öffentlich vorzuspielen, boten sich, wenn er als Stellenbewerber konkurrierte, oder ein neues Instrument entweder ausprobierte oder einspielte; sicherlich nützte Bach die ‘dorische’ Toccata und Fuge, BWV538, um sich in letztgenannter Fähigkeit im September 1732 in Kassel zu beweisen, und bereits im Alter von 18 Jahren (1703) verband er in Arnstadt diese beiden Tätigkeiten mit Erfolg, wobei er die Orgel mit solcher Fertigkeit ‘ausprobierte’, daß er selber als neuer Organist angestellt wurde. Sein Leben hindurch war Bach regelmäßig als Prüfer neuer Instrumente gefragt, und er hatte es zum Großteil dieser Fähigkeit zu verdanken, daß er sich verbreitet Ruhm als Virtuose, mit einer neuartigen und scharfen Kenntnis über die Registratur, verschaffen konnte.
Bach hätte sich keine bessere Musik, als diese mehrteiligen Stücke mit ihren breiten Entfaltungsmöglichkeiten in den Pedalsolos, der manualen Geschicklichkeit, ihrer strukturellen Vielfalt und in ihrer kontrapunktischen Virtuosität ausdenken konnen. Sie ermöglichen auch das Erkunden aller Spektren des Instrumentes durch die Betonungen einzelner oder hintereinander angeordneter Abteilungen und die Möglichkeiten für häufige Registerwechsel, die von ineinander übergehenden Kombinationen bis zu einem eng strukturierten pleno reichen, um jede verfügbare Luftversorgung auszuntüzen. In Verbindung damit sollte daran erinnert werden, daß es zu Bachs Zeiten (und auch heute noch) in Deutschland üblich war, einen Registranten anzustellen, der für den Wechsel des tonalen Spektrums behilflich war—eine Tradition, die in der vorliegenden Aufnahme nachvollzogen wurde.
Innerhalb dieser kleinen Gruppe von Werken ist es leicht zu erkennen, zu welchem Ausmaß sich Bach den herkömmlichen Umständen und nationalen Stilen, die unter seinen Blickfang gerieten, anpaßte, sie übereicherte und miteinander verband. Die norddeutschen Denkweisen sammelten sich in ihm von früh an sorgfältig durch seine Freundschaft mit Böhm in Lüneburg, Reinecken in Hamburg (1700-1702) und durch Buxtehude (1705-1706), während die nahe Entfernung von Lüneburg nach Celle ihn mit der dort begehrten französischen Musik bekannt machte. Dieses Intereße sollte Bach bis in seine Weimarer Jahre erhalten bleiben, wo er De Grignys Orgelwerke kopierte; und auch in der ‘Applicatio’, BWV994, vergegenwärtigen sich Ornamentierungen nach d’Anglebert.
In seiner Jugend hatte Bach grosse Ausmaße des süddeutschen Repertoires von Froberger, Kerll und Pachelbel kopiert, die außer der Abschrift von Frescobaldis Fiori Musicali (1635), welches er 1714 signiert hatte, sehr einflußreich auf die Bearbeitung des Italienischen Konzertes am Weimarer Hof wirkten.
Orgelminiaturen
Nikolaus Forkel unterteilt Bachs Orgelwerke in seinem 1802 erschienenen bibliographischen Aufsatz über den Komponisten in drei Kategorien: 1. große Präludien und Fugen (insgesamt zwölf, einschließlich der Werke in e-Moll, BWV533, g-Moll, BWV535, und d-Moll, BWV539, die Teil dieser Sammlung sind) sowie die Passacaglia; 2. Werke auf der Grundlage von Choralmelodien, die obligate Pedalstimmen erfordern und von denen Bach ganze siebzig Exemplare ausfindig gemacht hatte; 3. die ‘Sechs Triosonaten’ sowie einige zusätzliche Werke ähnlicher Art, die zwar von gewissem Interesse sind, jedoch nicht ganz an das Niveau der anderen Werke anknüpfen können. Forkel wertet alle anderen Werke, die seiner Meinung nach in unzähliger Ausführung in der ganzen Welt verstreut sind, als ‘erfolglose Griffe nach der Perfektion von Bachs reifem Stil’ ab, und im weiteren Verlauf seines Aufsatzes vermittelt er ein eher verzerrtes und romantisches Bild vom plötzlichen phönixhaften Aufstieg des ‘voll ausgereiften’ Komponisten.
Mangels Manuskriptmaterials ist es sehr schwierig, die Entstehungsdaten der meisten Bachschen Orgelwerke eindeutig zu bestimmen. Der Großteil der Musik dieser beiden CDs stammt jedoch mit großer Wahrscheinlichkeit aus den Jahren vor seiner Weimarer Zeit, als Bach Organist in Arnstadt und anschließend in Mühlhausen war. Wir können den jungen Komponisten hier dabei verfolgen, wie er Elemente des nord- und süddeutschen Orgelstils (wie sie von Buxtehude beziehungsweise Pachelbel verkörpert werden) zusammenträgt und verarbeitet und dies mit koloristischen und formalen Elementen der französischen Tastenmusik verbindet. Christopher Herrick hat für diese ‘Miniaturensammlung’ viele jener Gesellenstücke zusammengetragen, um dem Zuhörer das faszinierende Porträt eines Komponisten in seinen Lehrjahren präsentieren zu können. Die Sammlung umfaßt jedoch auch Werke aus Bachs Zeit in Weimar, Köthen und Leipzig und repräsentiert somit sein gesamtes kreatives Schaffen. Der Begriff ‘Miniatur’ ist hier übrigens keineswegs als Spiegelbild des Umfangs oder der Intention der Stücke zu verstehen, denn viele dieser Werke bergen wahrlich große Ideen in sich.
Friedrich Wilhelm Marpurg schrieb 1760: ‘Bach schüttelte sämtliche musiktechnische Finessen und Kunstgriffe, an denen jeder andere tagelang im Schweiße seines Angesichts arbeiten würde, einfach aus dem Ärmel.’ Diese CDs schicken uns auf eine faszinierende Entdeckungsreise, in deren Verlauf wir die Entwicklung von Bachs Kunst verfolgen können, insbesondere seine meisterhaften Fugenkompositionen. Diese Reise offenbart uns viele Schätze und zeigt uns, daß die ‘musiktechnischen Finessen’ stets dem musikalischen Ausdruck dienten und daß der Erfolg keineswegs einer ‘Miniatur’ gleicht.
Die Verbindung zu Italien
Der Forscher, der sich mit Bachs Orgeltranskriptionen befaßt, sieht sich zahlreichen Hindernissen gegenüber. In manchen Fällen beziehen sich die Probleme auf die Authentizität des Textes und auf die Urheberschaft, und mitunter nur auf die letztere. Auch die ungelöste Debatte, was denn der eigentliche Zweck der Transkriptionen war—gesetzt den Fall, daß sie tatsächlich von Bach stammen—erzeugt Probleme. Hinzukommt, daß im Zweiten Weltkrieg und der Nachkriegszeit unter chaotischen Umständen, die man sich leicht vorstellen kann, viel wichtiges Quellenmaterial verstreut wurde. Die weiseste Methode, die dem heutigen Kommentator zur Verfügung steht, ist daher, die wenigen gesicherten Tatsachen vorzutragen und es anderen anheimzustellen, ihre eigenen Schlüsse daraus zu ziehen.
Von den hier vertretenen Komponisten übten die am wenigsten bekannten den unmittelbarsten Einfluß auf Bach aus, wenn auch auf besondere Weise. Einer dieser Komponisten war Prinz Johann Ernst von Sachsen-Weimar (1696-1715), ein Neffe jenes Herzogs Wilhelm Ernst, der zwischen 1708 und 1717 Bachs Brotherr war. Prinz Johann, ein gewissenhafter, noch in der Ausbildung befindlicher Musiker, schickte zahlreiche Sendungen italienischer Partituren heim nach Weimar, während er zwischen Februar 1711 und Juli 1713 (in einem für heutige Begriffe recht zarten Alter) an der Universität Utrecht studierte. Nach seiner Rückkehr erhielt er Kompositionsunterricht von Johann Gottfried Walther (1684-1748), dessen Lebensdaten sich fast genau mit denen Bachs decken. (Walthers eigene Transkriptionen waren nach seiner eigenen Aussage achtundsiebzig an der Zahl, und dies gab Anlaß zur Vermutung, daß er sich in offenem Wettbewerb mit Bach befand. Allerdings sind nur vierzehn dieser Transkriptionen überliefert worden, und man nimmt an, daß viele nach Bachs Aufenthalt in Weimar entstanden.)
Was Bachs Transkriptionen anbelangt, so streitet man sich darüber, ob sie zum Selbstunterricht angefertigt wurden, oder ob der Komponist bei ihrer Schaffung das Weimarer Konzertrepertoire im Auge hatte, eventuell sogar in der Form von durch Prinz Johann erteilte Kommissionen. Diese spätere Ansicht, die in den letzten zwanzig Jahren von dem Kommentator Hans-Joachim Schulze geäußert wurde, stimmt mit der allgemeinen Kenntnis der damaligen Verhältnisse in Weimar überein, aber wurde aus spezifischeren Gründen von Peter Williams in seiner beachtlichen Studie The Organ Music of J S Bach (Cambridge, 1980) in Frage gestellt. Die frühere Auffassung, die Bachs Biograph Forkel bereits 1802 in gedruckter Form äußerte, wurde teilweise aus dem Grunde angefochten, daß der Autor auf reinen Vermutungen beruhen ließ, welche technischen Erleuchtungen Bach gesucht haben mag. Weiterhin wurde dieser Ansicht entgegengehalten, daß Ernst nur bescheidenes Talent besaß, und daß sich sein Werk daher Bach nicht als Jagdrevier anbot, es sei denn, Bach habe ihm schmeicheln wollen. Weitere Verwirrung entsteht, wenn wir Vivaldi berücksichtigen, auf den sich dieselben Argumente nicht anwenden lassen. Es kann sogar die Möglichkeit nicht ausgeschlossen werden, daß Ernsts und Vivaldis Werke aus ganz verschiedenen Gründen transkribiert wurden.
Trotz der obigen Betrachtungen sollte betont werden, daß es eher Ernsts bescheidene Leistung als Bachs Größe ist, die Forkels Theorie problematisch macht. Spätere Zeitalter haben Bach nahezu vergöttert, und man ist daher allzu leicht geneigt, jeglichen Begriff einer jugendlichen Entwicklung, jegliches Eingeständnis, daß es einmal eine Zeit gegeben haben muß, in der Bach noch nicht alles wußte, zu verwerfen. Ironischerweise trägt eine solche Haltung seiner Wißbegierde und seiner Fähigkeit, keimendes Genie mit Elementen herkömmlicher Tradition zu nähren, keine Rechnung. Im Falle von Vivaldi erkannte Bach zweifellos, daß er viel lernen konnte, und tat dies auch. Wir sollte uns vor Augen halten, daß er 1713 ein junge Mann von achtundzwanzig Jahren war.
Der amerikanische Gelehrte David Schulenberg weist auf die ‘Assimilation des venezianischen Konzertstils in andere Genres innerhalb Bachs Werk’ hin (The Keyboard Music of J S Bach; Gollancz, London, 1993). Diese begann seiner Ansicht nach schon vor 1713. Schweitzer geht sogar so weit, zu behaupten, daß Bach ‘seine Freiheit von Buxtehude mittels der Italiener errang’, und daß das Studium Legrenzis, Corellis und Vivaldis ihn das lehrte, was ihm Buxtehude und Froberger nicht vermitteln konnten: ‘Klarheit und Anschaulichkeit der musikalischen Struktur’ (J S Bach, aus dem Französischen übersetzt von Ernest Newman; Breitkopf und Härtel, London, 1911). Hinter dieser pauschalen Behauptung verbirgt sich mehr als nur ein Schimmer von Wahrheit. Es läßt sich nachweisen, daß Bach vor 1717 quasi-italienische Ritornellverläufe innerhalb geistlicher Kantaten bevorzugte, und das gleiche Phänomen ist in gewissen Präludien und Fugen und in einem besonders ‘unverkennbaren Typus des verzierten Adagios’ (Schulenberg) zu beobachten. Schulenberg datiert den Beginn der reifen Behandlung dieser stilistischen Verfeinerung auf 1714 und schließt berechtigterweise Sätze aus Bachs Konzerttranskriptionen mit ein.
Man nimmt an, daß Bach ungefähr zwanzig Konzertbearbeitungen unternahm. Fünf Bearbeitungen sind für Orgel mit unabhängigen Pedalstimmen, und zwei von diesen existieren in alternativen Fassungen mit Pedal (‘pedaliter’) und ohne Pedal (‘manualiter’). Man vermutet, daß der Rest für Cembalo konzipiert war. Weil die urkundlichen Quellen verstreut sind, bestehen Probleme der Echtheit wohl weiterhin, und Williams betont, daß es sich bei den Transkriptionen in keiner Weise um eine integrierte Gruppe handelt. Es existiert weder eine ‘Albumkopie’ noch ein vollständiges handschriftliches Manuskript. Trotz Walthers fortgesetzter Aktivität in diesem Bereich wird die Einstellung von Bachs Transkriptionsarbeit von vielen Autoren dem frühen Tode von Prinz Johann Ernst zugeschrieben, den er nach einer ein Jahr währenden Krankheit erlitt. Die Folgerung, daß die Nachfrage aus diesem Grunde endete, stärkt Schulzes Argument und schwächt Forkels Behauptung noch mehr.
Orgelmusik-Füllhorn
Dieses ‘Füllhorn’ enthält zahlreiche kürzere Stücke, darunter einige, die unvollständig sind, und einige, deren Zuordnung zu Bachs Schaffen umstritten ist. Leider ist dies nicht der Ort für eine detaillierte Erörterung der Annahme oder Ablehnung von Bachs Urheberschaft im Fall dieser Werke: Die ungeheure Blüte der Bachforschung vor allem seit dem Zweiten Weltkrieg ist mit dem allmählichen Aufbau der Fronten zwischen gegensätzlichen akademischen Faktionen einhergegangen und hat zu ausgesprochen hitzigen Debatten geführt. In Abwesenheit unumstößlicher Beweise müssen die Forscher zu quasiwissenschaftlicher Analyse Zuflucht nehmen. Indem sie stilistische Merkmale der in Zweifel gezogenen Werke mit denen vergleichen, deren Herkunft außer Frage steht, hoffen sie zu zeigen, daß Bach nicht der Komponist von Stücken gewesen sein kann, die technische Mängel oder einen schöpferischen Lapsus enthalten. Natürlich kann dieses Herangehen letztlich nur subjektiv sein. Wir wissen wenig über Bachs Ausbildung zum Komponisten und es schadet seinem Ruf gewiß nicht, wenn man akzeptiert, daß er Musik geschrieben haben könnte, die nicht an die Perfektion seines sonstigen OEuvres heranreicht. Für den Augenblick jedoch sollten wir von der Frage nach der Urheberschaft absehen und einfach eine Folge kleiner Kostbarkeiten genießen, die dem Hörer und Interpreten gleich viel Freude bereiten.
Das Trio nach dem weihnachtlichen Choral Herr Christ, der einig Gottes Sohn, BWV-Anhang 55 ähnelt dem vierten Satz der Kantate Nr. 140 Wachet auf, ruft uns die Stimme, die Bach als den ersten der Schübler-Choräle verarbeitet hat—die geringfügig verzierte Choralmelodie in der Tenorstimme steht einer Obligatomelodie der rechten Hand und einem Continuobaß der Pedale gegenüber.
Da die Autographen so vieler vollständiger Orgelwerke Bachs verschwunden sind, lohnt es sich, eigens darauf hinzuweisen, daß mit Ausnahme des Pedal-Exercitiums BWV598 alle unvollendeten Werke auf dieser CD in des Komponisten eigener Hand erhalten sind. Da alle von überragender Qualität sind, lassen sich interessante Spekulationen anstellen, was Bach davon abgehalten haben könnte, sie zu Ende zu führen. Während die Fantasia in C-Dur BWV573 eine definitive Kadenz erreicht, brechen die Fuge in c-Moll BWV562ii und die beiden Choräle mittendrin ab. Vielleicht handelt es sich um Kompositionsübungen zur Fortsetzung durch einen seiner Schüler. Zwar haben verschiedene Kenner des Bachschen Stils Ergänzungen der Fragmente hervorgebracht, doch Christopher Herrick zieht es vor, sie als ‘Torso’ darzubieten und verlockend ins Leere auslaufen zu lassen.
Die Orgelbüchlein
Vor, während und nach der Zeit Bachs dominierte der Choral—als geistliches Lied oder als Kirchenlied—das Wirken des Organisten der deutschen protestantischen Kirche. Seine Melodien und sein Wortlaut, die sich oft seit der Zeit Martin Luthers und der Reformation zweihundert Jahre zuvor kaum geändert hatten, waren eng miteinander verbunden und nur selten wurde eine Melodie für mehr als einen Text verwendet. Zusammen gaben sie die allgemeine Symbolik der jeweiligen Jahreszeit oder des jeweiligen religiösen Empfindens wieder; ja, sie bildeten in der Tat das Gefüge der liturgischen Musik, die von den Organisten geliefert wurde, und an der die Gemeinden mitwirkten.
Die Aufführungspraxis unterschied sich beachtlich von der, die wir heute als selbstverständlich betrachten. Erstens wurden die Choräle, wenn sie überhaupt gesungen wurden, nicht nur einstimmig und unbegleitet aufgeführt, sondern äußerst langsam. Trotzdem müssen wir bei Dr. Burneys 1772 während einer musikalischen Tournee Deutschlands notierter Bemerkung—nämlich daß er während des Singens eines Chorals eine Kirche betrat, sie wieder verließ, zwei Stunden später zurückkehrte und die Gemeinde denselben Choral singen hörte—berücksichtigen, daß es üblich war, einen einzigen Choraltext und seine Melodie fortlaufend während eines einzelnen Gottesdienstes zu verwenden (daher Bachs eigener Gebrauch desselben Chorals in einer Vielzahl von Erscheinungsformen im Laufe einer einzelnen Kantate) und daß, daß ein typischer Choraltext eine große Anzahl von Versen besitzt, an verschiedenen Stellen des Gottesdienstes verschiedene seiner Abschnitte zur selben Melodie gesungen wurden. Der Hauptgottesdienst am Sonntag (an dem Bach der Aufführung seiner wöchentlichen Kantate beizuwohnen pflegte) dauerte von sieben Uhr morgens bis zum Mittag, also volle fünf Stunden.
Zweitens konnte die Orgel, wenn sie zur Begleitung von Chorälen benutzt wurde, auf vielerlei Weisen mitwirken, wenn wir uns auch selbst heute nicht sicher sind, wie viele dieser Alternativen an irgendeinem Orte regelmäßig gebraucht wurden, oder inwieweit lokale Bedingungen Anzahl und Form der alternativen Spielweisen diktierten. Die uns überlieferten Gottesdienstordnungen (wenigstens die aus der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts) neigen dazu, ungewöhnliche oder besondere Anlässe eher als die üblichen aufzuführen. Hier mag die Bemerkung genügen, daß die Orgel auf jedem der folgenden Gebiete mit der Choralaufführung verbunden sein konnte: erstens, indem sie die Harmonie zur Begleitung des Gesanges hergab, und wahrscheinlich außerdem Zwischenspiele in der Form von improvisierten Schnörkeln zwischen den Versen, oder sogar den einzelnen Verszeilen, lieferte, und all dies in einer Weise, die schlicht genug war, um zu gewährleisten, daß die Harmonie nicht so kompliziert, und die Zwischenspiele nicht so brillant und unvorhergesehen waren, daß die Gemeinde in Verwirrung geriet (was dem jungen Bach in Arnstadt einst geschah, und wofür er vom Kirchenrat scharf getadelt wurde); zweitens, indem sie neben der Begleitung für die gesungenen Strophen längere und formal besser ausgearbeitete Zwischenspiele zwischen den Strophen lieferte (Choralpartiten oder Variationsreihen mögen gut auf diese Weise gebraucht worden sein, ebenso wie in ihrer dokumentierten Funktion als Vortragsstücke); drittens, indem sie den Choral mittels einfacher oder komplizierterer Orgelbehandlung einer Melodie einleitete, die so gut bekannt war, daß sie selbst in einem dichtstrukturierten Satz noch zu erkennen war; und letztlich, indem sie die Empfindung oder Stimmung eines Textes durch passende musikalische Behandlung der mit ihm verbundenen Melodie vor dem Mittelpunkt des Gottesdienstes—der Predigt—heraufbeschwor.
Es gibt Belege dafür, daß Choralvorspiele für Orgel zu diesem Zwecke gebraucht wurden, nämlich vor der Aufführung der Kantate innerhalb des Gottesdienstes, aber—erstaunlicherweise—auch mit dem Ziel, für die Instrumente, die in Vorbereitung für die Begleitung der Kantate gestimmt wurden, die Tonhöhe anzugeben und den durch das Stimmen verursachten Lärm zu überdecken. Der heute übliche ‘moderne’ Einsatz des Choralvorspiels—nämlich am Anfang und Ende des Gottesdienstes—wäre den im Zeitalter oder im Tätigkeitsfeld Bachs arbeitenden Organisten nie in den Sinn gekommen. Schließlich diente das Choralvorspiel vor allem dazu, die Liturgie von innen her zu illuminieren. Trotzdem wissen wir, daß Musik, die einen Choral zur Grundlage hatte, oft bei anderen, weltlicheren Anlässen eine Rolle spielte. Zum Beispiel konnte sie während eines öffentlichen Probevorspiels, wie es vor der Ernennung eines neuen Organisten üblich war, gespielt werden: hierbei wurde auf die Fähigkeit des Kandidaten, über eine Choralmelodie auf vielerlei Weisen zu improvisieren, großer Wert gelegt; während der Erprobung einer neuen Orgel (Bach selbst entwickelte zum eigenen Gebrauch bei solchen Anlässen eine geplante Gegenüberstellung von präludialen, fugalen und auf Chorälen basierenden Kompositionen); und weiterhin konnte sie bei den relativ selten stattfindenden Vorspielen zu hören sein, bei denen die improvisatorische Behandlung eines Chorals einen Teil des Programms bildete (von dem möglicherweise gewaltigsten Beispiel hierzu, nämlich Bachs halbstündiger Exposition von An Wasserflüssen Babylon vor Reinken im Jahre 1720 existiert keine Niederschrift).
DAS ORGELBÜCHLEIN
Unter den Choralpräludien, die Bach zu Papier brachte, wird das geplante Ausmaß der Sammlung mit dem Namen Orgelbüchlein durch ihren Titel Lügen gestraft. Dieser bezieht sich nämlich auf die Größe der Manuskriptseite (15.5 x 19 cm) und auf die präzisen Proportionen eines jeden einzelnen Choralsatzes, und nicht auf die geplanten 164 Titel, die nicht nur das ganze Spektrum der Jahreszeiten im Kirchenjahr umschließen sollten, sondern darüberhinaus für eine ganze Skala von Stimmungen und Anlässen geeignet sein sollten. Durch das ganze Buch hindurch hatte Bach diese aufgeführt und hatte, mit einigen wenigen Ausnahmen, der Behandlung einer jeden Stimmung oder eines jeden Anlasses eine einzelne Musikseite gewidmet. Wäre das Orgelbüchlein jemals fertiggestellt worden, so wäre es die umfassendste und ausgedehnteste existierende Sammlung von Choralvorspielen gewesen. Aus Gründen, die im folgenden dargestellt werden, vollendete Bach nur sechsundvierzig.
Im Advent 1713 begann er, die Sammlung zu erstellen, und bei Beginn der Passionszeit des Jahres 1716 hatte er alles außer den wenigen späteren Zusätzen und Bearbeitungen abgeschlossen. Es mag sein, daß einige dieser späteren Stücke früher geschrieben waren und (in Bachs überaus eleganter Handschrift und scheinbar in aller Ruhe) in die Sammlung hineinkopiert wurden, während andere so aussehen, als habe er sie in der Hitze der Inspiration eilig hingekritzelt. Etliche überschritten die vorgesehene Länge und wurden am unteren Seitenrand oder auf eingeschobenen losen Blättern (von denen seither eines verlorengegangen ist) zu Ende geführt. Zu dieser Zeit war Bach Hoforganist in Weimar und auf der Höhe seines Wirkens als Orgelvirtuose. Es lag ihm jedoch hier nicht daran, sich Stoff für sein eigenes virtuoses Spiel zu schaffen, sondern, wie seine interessante und informative Titelseite uns mitteilt: ‘Worinne einem aufahenden Organisten Anleitung gegeben wird, auff allerhand Arth einen Choral durchzuführen, an—bey auch sich im Pedal studio zu habilitiren, indem in solchen darinne befindlichen Choralen das Pedal gantz obligat tractiret wird.’ Diese Titelseite wurde der Sammlung während Bachs Amtszeit als Kapellmeister in Köthen hinzugefügt. Die Stellung hatte er im Juni angenommen, aber sechs Monate später war er nicht in der Lage gewesen, sie anzutreten. Es mag sein, daß seine anfängliche Motivation rein praktischer Art war, oder aber eher didaktischer Art (nach seiner Ankunft in Köthen hatte Bach sich mit Sicherheit eher der letzteren Schreibweise zugewandt); fest steht jedoch, daß sein gesamtes schöpferisches Vorstellungsvermögen auf für ihn typische Weise sehr viel mehr bedeckte als allein die offensichtlich nützliche Schaffung kurzer, technisch anspruchsloser Tonsätze einer klugen Auswahl von Chorälen, welche die wichtigsten Feiertage und Stimmungen des Kirchenjahres erfaßten.
Wir wissen nicht, welche Werke Buxtehudes Bach während seiner Pilgerfahrt nach Lübeck im Jahre 1705 hörte, doch macht die im Orgelbüchlein vorherrschende Form—der sogenannte Melodiechoral—deutlich, daß er von seinem älteren Zeitgenossen viel bezüglich der präzisen Strukturierung kürzerer Choralvorspiele lernte. Buxtehude war der langgezogenen, oft ziellosen Weitschweifigkeit der Choralfantasien und der Reihen von Choralvariationen aus dem Wege gegangen, die so eifrig von seinen Zeitgenossen und Vorläufern von Sweelinck bis hin zu Scheidt, Tunder und Weckmann praktiziert worden war. Stattdessen hatte er sich in den dreißig uns erhalten gebliebenen Beispielen seiner Werke in bemerkenswertem Maße darauf konzentriert, den präzisen Satz einer Choralmelodie (gewöhnlich in der obersten Stimme) mit oder ohne Zwischenspiele oder verwandte kontrapunktische Behandlung zwischen den Einsätzen einer jeden Melodiezeile genau zu definieren. In seinem Orgelbüchlein perfektionierte Bach diese Form. Er schrieb normalerweise keine Zwischenspiele, doch legte er den untermauernden Kontrapunkt, der motivisch mit der Choralmelodie selbst verwandt war, äußerst raffiniert an, oder aber (was noch häufiger geschah und die große von Bach beigetragene Neuerung darstellt) er setzte den eigenständigen motivischen Charakter der Begleitung bewußt in Kontrast zur Choralmelodie, während er zugleich selbstverständlich Sorge trug, daß diese motivische Eigenheit den Charakter des mit der Melodie assoziierten Textes komplementär unterstützte.
Es sollte nicht vergessen werden, daß die instrumentalen Konzerte Vivaldis und seiner Zeitgenossen während der Weimarer Schaffensperiode (in welcher der größte Teil des Orgelbüchleins komponiert wurde) die bedeutendsten zeitgenössischen Einflüsse im instrumentalen Bereich darstellten. Bach schuf Orgelbearbeitungen von Vivaldis eigenen, sowie von anderen, eher imitierenden Konzerten (unter welchen sich die des Prinzen Ernst, eines von italienischer Musik inspirierten, doch kurzlebigen Komponisten aus dem herzöglichen Hause von Weimar befanden), und diese Erfahrung ließ ihn vollständig neue Horizonte der instrumentalen Methode erblicken. Vivaldis kühne, kurzatmige Motive verliehen dem die langgezogenen Phrasen und trägen Konturen der Choralmelodien begleitenden Kontrapunkt eine markige Energie und gaben den ungewöhnlich prägnanten aber durchdringenden Miniaturen, an denen sich Bach hier zum ersten Mal versuchte, einen unmittelbaren Zusammenhalt. (Er sollte diese Miniaturen während seiner späteren Laufbahn bei mehreren Gelegenheiten wieder verwenden.) Natürlich verlieh er, wie wir sehen werden, seinen Vorlagen größere geistige Inhalte, aber trotzdem stellt sich uns die Frage, ob es irgendeinen praktischen Grund gab, warum seine Ernennung zum Organisten des Weimarer Hofs es erforderte, daß sein Schaffen sich in dieser Richtung entwickelte.
Die Kunstfertigkeit und Vielfalt von Bachs Behandlung des Choralmotivs in den sechsundvierzig von ihm (in diesem beengend kurzgefaßten Genre) vollendeten Sätzen ist derart, daß es scheint, als habe sogar er alle Möglichkeiten ausgeschöpft. In seinen Leipziger Jahren (c1740) fügte er lediglich einen vollständigen Entwurf (O Traurigkeit, o Herzeleid) und einen weiteren unvollständigen Choral (Helft mir Gottes Güte preisen, BWV613) hinzu. Zur selben Zeit revidierte er etliche andere und nahm die Arbeit an zwei seiner Originalsätze wieder auf, um erweiterte und ausgefeilte Neubearbeitungen zu entwickeln, die in die Sammlung der ‘Großen 18’ aufgenommen werden sollten. Ein weiterer Grund dafür, daß er dieses größte seiner unvollendeten Projekte nicht abschloß, mag darin bestehen, daß die sechsundvierzig von ihm verfaßten Präludien die wichtigsten mit den Jahreszeiten und Ereignissen des Kirchenjahres verbundenen Melodien aufgebraucht hatten; die übrigen Titel, für die er eine betitelte leere Seite Notenpapier beiseitegelegt hatte, sollten eine Gefühlsskala ausdrücken, die so breit und suggestiv war, daß er sie in seinem reifen Stil nicht adäquat auf so engem Raum unterbringen konnte; wir dürfen nicht vergessen, daß nur wenige der im Orgelbüchlein enthaltenen Präludien eine Länge von fünzehn Takten überschreiten.
Es stellt sich die Frage, wie man diese verblüffend reiche Folge meisterhafter Miniaturen, von denen jede intendiert war, einzeln und in streng voneinander abgegrenzten liturgischen Kontexten gehört zu werden, aufzeichnen und hören soll. Christopher Herricks entwarf eine Reihenfolge des musikalischen Vortrags, in welcher die nicht an bestimmte Jahreszeiten gebundenen Choräle in die grundlegende Struktur der jahreszeitlich bedingten Sequenz, die vom Advent über Weihnachten, Neujahr, die Passionszeit und Ostern bis zur Himmelfahrt und Pfingsten reicht, eingestreut werden—ganz wie Bach selbst es beim praktischen Gebrauch seiner eigenen Sammlung über den Zeitraum eines ganzen Jahres getan haben würde.
Die Schübler Choräle
In den letzten Jahren seines Lebens veröffentlichte Bach einige Stücke, die wahrhaftig eine Art musikalisches Vermächtnis darstellen. Sie bilden die Summe seines künstlerischen Schaffens.
Die Schüblerschen Choräle sind nach einem Schüler Bachs benannt, der das Notenstechen und die Veröffentlichung dieser Stücke arrangierte. Sie repräsentieren eine von zwei Arten der Orgelmusik Bachs, die zu seinen Lebzeiten veröffentlicht wurden. Die Orgelchoräle haben eine liturgische Struktur, indem sie sowohl in einer Kirchenjahrsequenz und als Vorbereitung auf den Advent enwickelt sind, als auch das Fortschreiten des christlichen Daseins von der Wiege christlichen Bewußtseins bis ins Grab und darüber hinaus beschreiben.
Fünf der Choräle sind mit Sätzen der Kirchenkantaten aus den Jahren 1724/5 und 1731 verbunden und für die liturgischen Dienste der Thomaskirche in Leipzig geschrieben worden, wo Bach 1723 eine Stellung als Kantor einnahm. Es ist wahrscheinlich, daß die Kantatensätze zuerst komponiert und dann für Orgel umgeschrieben wurden. Die vorherrschende Tendenz in Bachs Transkriptionen war es, Werke größeren Umfangs für Tasteninstrumente umzuschreiben. Das Obligato aus dem fünften Schüblerschen Präludium erforscht eine ‘Kreuz-Saiten’-Komposition und deutet unmißverständlich darauf hin, daß es aus der Kantatenversion stammend für Klaviatur umgeschrieben wurde. Auf ähnliche Weise enthält das vierte Präludium, hervorgerufen durch das fehlende Continuo, eine Trostlosigkeit, die auch in den langsamen Sätzen der ersten beiden ‘Orgel’-Konzerte zum Vorschein kommt.
Die Choräle sind keine willkürliche Sammlung, sondern eine wahre Freude für jene, die die Musik Bachs nach Symbolen absuchen, nicht zuletzt, daß auf halbem Weg die Buchstaben BACH (BWV648, Taktstrich 7 und 8) erscheinen. Verschiedene Zahlenkombinationen können zusammengerechnet den Namen BACH bilden, und auch die Anweisung zum Cantus firmus, das in jedem Vorspiel von einer bestimmten Stimme gesungen werden soll, kann, wie tatsächlich viele der Tonartbeziehungen zwischen den Vorspielen, von symbolischer Bedeutung sein. Zahlensymbolik scheint auch im Hinblick auf die Trinität äußerst wahrscheinlich zu sein. Zum Beispiel ist jedes Stück dreistimmig, und die Erststimme dieser Reihe erscheint in Bachs ‘Trinitatis’-Tonart Es-Dur.
Leipziger Choräle (die 'archtzehn')
Dies ist noch eine Sammlung von Choralpräludien, die aus Bachs letzten Jahren stammen. Sie sind uns in einem größtenteils handschriftlichen Manuskript erhalten geblieben, das auch die Orgelsonaten und die Kanonischen Veränderungen über das Weihnachtslied Vom Himmel hoch enthält. Die Choräle bilden einen anderen Teil der musikalischen Vermächtnisse Bachs und bestehen aus Präludien, die nach zahlreichen verschiedenen Techniken komponiert wurden. Sie entstanden wahrscheinlich während der Zeit, die er in Weimar verbrachte, wo er 1708, ein Jahr nach seiner Heirat mit Maria Barbara, eine Stellung als Hoforganist innehatte. Der junge Herzog von Weimar lebte ein Leben in religiöser Leidenschaft und Hingebung und erwartete dasselbe von seinen Angestellten. Es scheint eine Empathie zwischen Bach und dem Herzog gegeben zu haben, und der Bitte Bachs nach einer umfassenden Rekonstruktion der Orgel wurde mit Freude nachgekommen. Somit fand der Komponist sich an einem Ort wieder, der sowohl für seine geistige Entwicklung als Komponist liturgischer Orgelmusik als auch von den Einrichtungen her richtig war.
Die Präludien greifen verschiedene Stilrichtungen deutscher Orgelmusik auf, die Bach von Böhm und Buxtehude im Norden und Pachelbel im Süden hinterlassen wurden. In ihnen werden Choralmelodien auf verschiedene Art und Weise vertont und wiederaufgenommen, jedoch in einer Stimmlage durch die gesamte Komposition als Cantus firmus geführt, entweder einfach oder sorgfältig ausgearbeitet. In einigen der Präludien sind die hauptsächlichen strukturellen Musikelemente von den Choralnoten selbst abgeleitet.
Bach überarbeitete während seiner Zeit in Leipzig viele dieser Choräle, weshalb ihnen hier dieser Titel gegeben wird. Es gibt in dieser Sammlung von Präludien ein unvollendetes Element, dem keine besonderen logischen oder liturgischen Überlegungen zugrundeliegen zu scheinen. Der achtzehnte Choral dieser Sammlung, Vor deinem Thron, ist unvollendet und in einer anderen Handschrift verfaßt, weshalb keine Gewißheit besteht, daß er zu Bachs Konzeption dieser Sammlung gehörte.
Die Kirnberger Choräle
Johann Philipp Kirnberger war ein Komponist und Theoretiker, der ungefähr ein Jahrzehnt vor dem Tode Bachs als dessen Schüler nach Leipzig kam. Er sollte Bach später für dessen Beitrag zur Musik vergöttern, und in seinen theoretischen Schriften versuchte er zu ergründen, was Bach getan hätte, wenn er selbst Abhandlungen geschrieben hätte. Aber wie die größten Sammlungen von Werken, die aus den letzten Jahren Bachs stammen zeigen, hinterließ er der Nachwelt seine Theorien nicht in Worten, sondern in der Musik. Für uns ist es ein Glück, daß Kirnberger auf eine Weise für das Zusammentragen der Sammlung von Präludien, die nach ihm benannt wurden, verantwortlich war, denn er verbrachte vierzehn seiner späten Jahre in Berlin damit, Werke Bachs für die Prinzessin Anna Amalia von Preussen zu sammeln. Die Sammlung mag nicht die Substanz jener Sammlungen haben, die vom Komponisten selbst geschaffen wurden, sie stellt jedoch einen wertvollen Schatz von Präludien verschiedenen Umfangs und Stils dar. Die Choräle sind wahrscheinlich in Manuskriptform unter der Leitung Kirnbergers, jedoch nicht von ihm selbst, gesammelt worden. Sie bilden keine kohärente Ausgabe wie das ‘Orgelbüchlein’ und ihre Entstehungsdaten sind unbekannt. Trotzdem scheint es im Hinblick auf die Advents- und Weihnachtschoräle eine Art Ordnung zu geben, und die Ähnlichkeit der Fugetten deutet die Bildung eines Satzes an. Die Fugetten beginnen die jeweils folgenden Abschnitte. Jede ist in sich kurz, drei- oder vierstimmig und auf zwei Linien geschrieben, obwohl das Orgelpedal in diesen Aufnahmen nur sparsam verwendet wird, um die Choräle hervortreten zu lassen.
Die Clavierübung und andere ‘grosse’ Choräle
‘So ist es auch an dem, daß mein Herr Vetter einige Clavier Sachen, die hauptsächlich vor die Herrn Organisten gehören u. überaus gut componirt sind, heraus wird geben, welche wohl auf kommende Oster Meße mögten fertig werden …’ (10 janvier 1739)
Wie sich herausstellte, war die Vorhersage von Johann Elias Bach, der dem Komponisten als Sekretär diente, eher optimistisch, und der großzügig ausgestattete dritte Teil der Clavierübung erschien erst zu Michaeli, d.h. am 29. September, zum Preis von drei Talern. Das war 1739 eine nicht unerhebliche Summe, und es kann nicht verwundern, daß selbst solche Musik, die gestochen und gedruckt vorlag, weiterhin in Manuskriptform in Umlauf war. Der Band unterschied sich vom Inhalt wie auch von der Intention her erheblich von seinen beiden Vorgängern. Der 1731 erschienene erste Teil der Clavierübung faßte die sechs Partiten zusammen, die Bach zwischen 1726 und 1730 als Einzelwerke herausgegeben hatte. Der zweite Teil umfaßte zwei Werke: das Italienische Konzert und die Französische Ouvertüre. Als Instrument war jeweils das Cembalo vorgesehen (für den zweiten Teil ein zweimanualiges), so daß beide Teile trotz der dafür nötigen virtuosen Spieltechnik in erster Linie auf den Hausgebrauch zugeschnitten waren. Damit konnte sich der Komponist ihrer weiten Verbreitung in einem spezifischen Sektor des Marktes sicher sein. Der Inhalt des dritten Teils ist viel breiter gefächert, und daß er für unterschiedliche Instrumente konzipiert wurde, ist nicht ganz so einfach auszumachen, an wen sie sich richteten.
Die Sammlung besteht aus einundzwanzig Choralvorspielen, wobei jede Melodie in zwei deutlich voneinander abgehobenen Sätzen erscheint. Der eine ist eine großangelegte Komposition, die ein Instrument mit zwei Manualen und Pedal erfordert, während die zweite und in der Regel erheblich kürzere für Manuale allein gedacht ist. Die einzige Ausnahme gegenüber diesem Aufbau ist Allein Gott in der Höh sei Ehr, das dreimal vorkommt. Gewisse Merkmale der Stimmführung in den kürzeren Fassungen deuten darauf hin, daß sie ebenso gut auf dem Cembalo wie auf der Orgel zu spielen wären. Daneben enthält der Band noch vier Duette (sie liegen in einer bereits erschienenen Aufnahme dieser Serie vor: ‘Organ Miniatures’), die zwar nicht die Grenzen der Orgeltastatur überschreiten, aber stilistisch den zwei- und dreistimmigen Inventionen viel näherstehen und sich darum ebenso zur Darbietung auf dem Cembalo oder Klavichord eignen. Am Anfang bzw. Ende der Sammlung steht das mächtige Präludium und Fuge in Es-Dur, die einzige derartige Paarung, die zu Lebzeiten des Komponisten veröffentlicht wurde.
Die ersten vier Choräle, die Bach verwendet, sind die lutherischen Fassungen des Kyrie und des Gloria, und aus diesem Grund ist der dritte Teil der Clavierübung oft irreführend als ‘Deutsche Orgelmesse’ bezeichnet worden. Wir wissen, daß Bach Exemplare von Frescobaldis Fiori Musicali und de Grignys Livre d’Orgue besaß und sie sehr schätzte. Doch erfüllten sie eine ganz andere Funktion als seine eigene Sammlung—wie viele ähnliche Publikationen boten sie eine Auswahl an Stücken, die alternatim mit dem cantus planus der Messe gespielt werden konnten. Obwohl einige der kürzeren Präludien der Clavierübung III als Einleitungen zum Gemeindegesang hätten dienen können, kann man sich nur schwer vorstellen, daß die umfänglicheren Sätze eine eindeutige liturgische Funktion hatten. Die anderen sechs Choräle befassen sich mit Themen aus dem Bereich katechetischer Doktrin: den zehn Geboten (Dies sind die heilgen zehn Gebot), dem Glaubensbekenntnis (Wir glauben all an einen Gott), dem Vaterunser (Vater unser im Himmelreich), der Taufe (Christ, unser Herr, zum Jordan kam), der Buße (Aus tiefer Not schrei ich zu dir) und dem Abendmahl (Jesus Christus, unser Heiland). Demzufolge hatte das Werk für seinen Verfasser wohl besondere Bedeutung als eine Art theologischer Summa; andererseits ist es eine umfassende, wenn auch nicht erschöpfende Übersicht über die möglichen Stile des Choralsatzes für die Orgel. Allein als Darstellung von Kompositionstechniken betrachtet ist es absolut überwältigend und weist voraus auf spätere rekapitulierende Werke wie das Musikalische Opfer und die Kunst der Fuge.
Die Partitas und canonische Veränderungen
Jeder Organist im protestantischen Europa Ende des 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts würde den Choral ins Zentrum seines Schaffens gestellt haben, und für J S Bach waren wie für jeden anderen Komponisten-Organisten seiner Zeit das Aufgreifen und die Erschließung von Material aus dem Bereich des Chorals eine lebenslange Aufgabe. Im Falle Bachs, des großen Verarbeiters von nationalen Stilrichtungen, strukturellem Symbolismus und numerologischem Mystizismus, sollten die erweiterten technischen und musikalischen Möglichkeiten, welche die von ihm vertonten Choralmelodien bargen, obendrein zur Leidenschaft werden. Daß die Orgelchoralpartita oder Suite, deren Einzelteile auf Variationen ein und derselben Choralmelodie beruhen, von allen Formen der Choralbearbeitung in seinem Gesamtwerk die kleinste Gruppe ausmachen, liegt teils an seiner Entwicklung als Komponist und teils an den praktischen Gegebenheiten.
Es ist klar, daß Bachs zunehmend konzentrierte Erforschung von Stimmung und Motiv seine Aufmerksamkeit stärker in Richtung einer einzigen, allumfassenden, vollendeten Vertonung des jeweiligen Chorals lenkte (obwohl er zu einem späteren Zeitpunkt oft auf die gleiche Melodie zurückkam, um eine Neuvertonung aus anderer Sicht vorzunehmen), statt auf eine Serie weniger objektiv erschöpfender Variationen, deren jede hinter dem zurückbleiben mußte, was er in einer Einzelvertonung zu leisten vermochte. Die zwei recht unterschiedlich konstruierten und durchkomponierten Vertonungen von Christ ist erstanden (BWV627) und O Lamm Gottes, unschuldig (BWV656) mögen Ausnahmen sein, doch hat Bach eindeutig in einem relativ frühen Stadium seines Werdegangs das Interesse an reinen Choralpartiten verloren und sich erst in den letzten Lebensjahren unter besonderen Umständen erneut darauf besonnen. Auf jeden Fall nahmen die Gelegenheiten, derart vollständig ausgearbeitete bzw. ausgeschriebene Stücke aufzuführen, im Laufe des 18. Jahrhunderts immer mehr ab.
Die Ursprünge der Choralpartita sind in den 100 Jahre früher von Sweelinck komponierten Konzertvariationen über Choralmelodien zu suchen. Diese Stilrichtung, Produkt der Freundschaft Sweelincks mit John Bull, beruhte auf den Variationstechniken der Virginalisten im elisabethanischen England und wurde in Norddeutschland von Sweelincks Schülern Scheidt und Scheidemann eingeführt. Auf deren Werke baute Buxtehude, Reincken und Böhm im Norden und weiter südlich Pachelbel auf (der au erdem stilistische Einflüsse aus Italien verarbeitete). Sweelincks Vorlagen waren zum konzertanten Gebrauch bestimmt, gemäß den seinerzeit in den Niederlanden herrschenden strengen calvinistischen Ansichten, die derart weltliche Virtuosität im Sakralbereich ausschlossen. In Deutschland dagegen setzte sich die Choralpartita bald in zweierlei Hinsicht durch.
Die alte vorreformatorische Sitte, gesungene Choral- und Orgelstrophen (nach der gleichen Melodie) abzuwechseln, wurde in den neuen Brauch übernommen, wonach die Verse des von der Gemeinde fürunsere Begriffe sehr langsam gesungenen Chorals von der Orgel eingeleitet wurden und mit ihr alternierten. In den Einschben zwischen den Versen überschritten die Choralvariationen der Orgel insofern ihre rein praktische Funktion (die Gemeinde wieder zu Atem kommen zu lassen), als sie die Stimmung des gesungenen Texts nachempfanden oder vorwegnahmen. In der Praxis wurden die sorgsam komponierten und ausgearbeiteten Orgelvariationen selbst in Anbetracht der ungewöhnlichen Länge deutscher protestantischer Gottesdienste als zu lang empfunden, und obendrein bei fortschreitender Kompositionstechnik als unangenehm kompliziert. Improvisierte Zwischenspiele, die den jeweiligen Umständen genau entsprachen, wurden daraufhin zur flexibleren und akzeptierten Norm.
Die Technik der durchkomponierten wie der improvisierten Choralvariation wurde weiter gefördert durch die Solodarbietung, die der Organist seiner Gemeinde einmal im Jahr zu geben pflegte, um den Stand und die Entwicklung seines Könnens zu demonstrieren, sowie durch die Spielprobe, die der Bewerber um einen neuen Posten abgeben mußte und die von ihm verlangte, einen vorgegebenen Choral in allen gängigen Kompositionsstilen zu improvisieren. Das heißt, daß Bachs größte Leistung auf diesem Gebiet möglicherweise nie schriftlich niedergelegt wurde. Den Anhaltspunkt dafür liefert sein Nachruf, der im Detail auf Bachs Hamburgfahrt eingeht, als er 1720 dort Reincken vorspielte. Auf Reinckens Wunsch improvisierte er fast eine halbe Stunde lang über das Thema An Wasserflüssen Babylon, und zwar nach Reinckens Aussage auf vollständige, mannigfaltige Weise, wie es die besseren unter den Hamburger Organisten ehedem bei der samstäglichen Vesper gewohnt waren. Reincken soll damals ausgerufen haben: ‘Ich dachte, diese Kunst sei ausgestorben, aber wie ich sehe, lebt sie in Euch weiter.’
Die Neumeister Choräle
Während die meisten von uns davon träumen, im Lotto zu gewinnen, ist es wohl das Lebensziel eines jeden Musikforschers, einmal das bislang unbekannte Manuskript eines bedeutenden Komponisten zu entdecken. Das Gefühl der Erfüllung muß umso intensiver sein, wenn die Entdeckung eine eklatante Lücke in unseren Kenntnissen über den betreffenden Komponisten schließt. Das Originalmanuskript eines (bekannten oder unbekannten) Orgelwerks von Bach wäre beim Mangel an derartigen Autographen natürlich ein wahrhaft seltener Fund, aber was Professor Christoph Wolff und Harold E Samuel, der Musikarchivar der Universität Yale, tatsächlich in der John Herrick Jackson Musikbibliothek von Yale fanden, kam dem recht nahe. Diese Sammlung ist eine riesige Fundgrube für Quellenmaterial des 17. und 18. Jahrhunderts, und Wolff und Samuel haben im Zuge der Untersuchung einer Anthologie von Choralvorspielen in Manuskriptform, die im letzten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts von Johann Gottfried Neumeister zusammengestellt wurde, mehr als 30 bislang unbekannte Choralvorspiele aus den prägenden Lebensjahren des Johann Sebastian Bach identifiziert. (Ein großer Teil der Sammlung harrt nach wie vor der detaillierten Untersuchung: Wer weiß, welch andere Schätze sich noch darin verbergen.) Natürlich ist die Zuordnung von nichtautographischem Material mit einem Element der Spekulation behaftet, und es gibt Menschen, die nicht wahrhaben wollen, daß aus der Feder Bachs etwas anderes als Perfektion geflossen sein könnte, ganz gleich, in welchem Stadium seiner Entwicklung er sich befand. Doch das Vorhandensein von sieben Stücken, die aus anderen Quellen bekannt sind, ermutigte Wolff und Samuels dazu, ihre Schlußfolgerungen bekanntzugeben und die Werke 1985 zur Veröffentlichung vorzubereiten.
Neumeister war Lehrer und Teilzeitorganist, und der Schwerpunkt der Sammlung auf relativ einfachen Stücken, die meist ohne Pedal gespielt werden können, ist vermutlich auf sein bescheidenes Können im Umgang mit dem Instrument zurückzuführen. Das Manuskript ist ganz ähnlich wie das Orgelbüchlein angelegt—das heißt, als vollständige Serie von Stücken für das Kirchenjahr. Man kann darüber spekulieren, ob Neumeister aus einer bestehenden Anthologie abgeschrieben oder seine eigene Auswahl aus unterschiedlichen Quellen getroffen hat, wobei er sich an Bachs Schaffen orientierte. Wie auch immer: Es ist interessant, festzustellen, daß 22 der vorliegenden Choräle im Orgelbüchlein zwar erwähnt werden, aber nicht in vertonter Form enthalten sind und daß mehrere nirgendwo anders in Bachs Choralschaffen vorkommen. Irgendwann ging die Anthologie in den Besitz von Christian Heinrich Rinck über, der bei J C Kittel studiert hatte, einem von Bachs letzten Schülern; er war ein eifriger Sammler von Bach-Memorabilien und trug viel dazu bei, seine Tradition lebendig zu erhalten. Die insgesamt 82 Choralvorspiele der Sammlung stammen von sieben Komponisten, darunter die weitaus bedeutendsten Beiträge von zwei Generationen der Familie Bach. Neben den 38 Chorälen von Johann Sebastian liegen 25 von Johann Michael Bach vor, einem Vetter seines Vaters Johann Ambrosius, dessen Vokalmusik er noch während seiner Zeit in Leipzig aufzuführen pflegte. (Johann Michaels Tochter Maria Barbara war Johann Sebastian Bachs erste Frau.) Die anderen vertretenen Komponisten sind Johann Christoph Bach (ein weiterer Vetter), Zachow, Pachelbel, Erich und Sorge.
Hyperion Records Ltd ©


