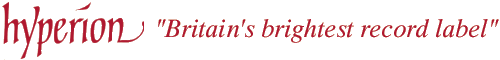
Welcome to Hyperion Records, an independent British classical label devoted to presenting high-quality recordings of music of all styles and from all periods from the twelfth century to the twenty-first.
Hyperion offers both CDs, and downloads in a number of formats. The site is also available in several languages.
Please use the dropdown buttons to set your preferred options, or use the checkbox to accept the defaults.



John Eliot Gardiner, The Monteverdi Choir and The English Baroque Soloists head to Italy to give two concerts, in the cathedral of San Lorenzo in Genoa and the basilica of Santa Maria sopra Minerva in Rome. The internationally acclaimed soloists include Magdalena Kožená, Sara Mingardo, Christoph Genz and Peter Harvey.
 RECORDING
RECORDING PERFORMANCE
PERFORMANCE
With weekly preparations leading to the performance of these extraordinary works, a working rhythm we sustained throughout a whole year, our approach was influenced by several factors: time (never enough), geography (the initial retracing of Bach’s footsteps in Thuringia and Saxony), architecture (the churches both great and small where we performed), the impact of one week’s music on the next and on the different permutations of players and singers joining and rejoining the pilgrimage, and, inevitably, the hazards of weather, travel and fatigue. Compromises were sometimes needed to accommodate the quirks of the liturgical year (Easter falling exceptionally late in 2000 meant that we ran out of liturgical slots for the late Trinity season cantatas, so that they needed to be redistributed among other programmes). Then to fit into a single evening cantatas for the same day composed by Bach over a forty-year span meant deciding on a single pitch (A = 415) for each programme, so that the early Weimar cantatas written at high organ pitch needed to be performed in the transposed version Bach adopted for their revival, real or putative, in Leipzig. Although we had commissioned a new edition of the cantatas by Reinhold Kubik, incorporating the latest source findings, we were still left with many practical decisions to make over instrumentation, pitch, bass figuration, voice types, underlay and so on. Nor did we have the luxury of repeated performances in which to try out various solutions: at the end of each feast-day we had to put the outgoing trio or quartet of cantatas to the back of our minds and move on to the next clutch—which came at us thick and fast at peak periods such as Whitsun, Christmas and Easter.
The recordings which make up this series were a corollary of the concerts, not their raison d’être. They are a faithful document of the pilgrimage, though never intended to be a definitive stylistic or musicological statement. Each of the concerts which we recorded was preceded by a ‘take’ of the final rehearsal in the empty church as a safety net against outside noise, loud coughs, accidents or meteorological disturb ance during the performance. But the music on these recordings is very much ‘live’ in the sense that it is a true reflection of what happened on the night, of how the performers reacted to the music (often brand new to them), and of how the church locations and the audiences affected our response. This series is a tribute to the astonishing musicality and talent of all the performers who took part, as well as, of course, to the genius of J S Bach.
Cantatas for the Twentieth Sunday after Trinity
San Lorenzo, Genoa
Leaving behind us the austerity of Wittenberg, with its fiery celebrations of the Reformation festival, and with the pastor’s parting words (‘Carry the good work on to Rome!’) still ringing in our ears, we were now headed for Italy, first to Genoa and then to Rome, seat of Luther’s Antichrist. Pope John Paul II had recently published two papal bulls, one forbidding the performance of all non-sacred music in churches and, when that proved impossible to define, a second banning all church concerts. Fortunately there are still a few dissident music-loving Catholic priests and even cardinals who are prepared to soften this approach, with the happy result that we were to give two concerts, one in the cathedral of San Lorenzo in Genoa and one the following day in the basilica of Santa Maria sopra Minerva in Rome.
The Gospel reading for the Twentieth Sunday after Trinity is the parable of the royal wedding feast (Matthew 22: 1-14). It prompts many figurative references to the soul as bride, to travel, to clothing and to food, such as Jesus as the ‘bread of life’, and Bach came up with three settings all marked in their way by this imagery, each one creating a distinctive sensuous atmosphere by means of scoring, vocal writing, special sonority, or a mixture of all three.
First came a cantata composed for the Weimar court in 1716, revived, transposed and recopied in Leipzig in 1723. Salomo Franck’s strongly worded libretto for BWV162 Ach! ich sehe, itzt, da ich zur Hochzeit gehe compares life with a journey to a nuptial feast. The outcome—happiness or misery—depends partly on the company you keep and partly on whether as a wedding guest you prove worthy of the invitation. Franck has a love of poetic compounds and polar opposites, so in the opening bass aria we get references to ‘Seelengift’ (poison of the soul) and ‘Lebensbrot’ (bread of life), heaven and hell, life and death, rays of heaven and fires of hell. This is some wedding: no wonder the last line is ‘Jesus, help me to survive!’ With its antiphonal violins and oboes (initially in canon) and an unusual part for a corno da tirarsi (played here by an alto trombone) Bach’s music is solemn in mood, its structure of the Fortspinnung type based on a ritornello with sequential repetitions. The ‘journey’ continues in the soprano aria ‘Jesu, Brunnquell aller Gnaden’ (No 3), in which the refreshment of cooling wayside water is evoked in 12/8 metre and via the obbligato lines for flute and oboe d’amore reconstructed for us by Robert Levin. The placid mood and flowing lines are disturbed in the ‘B’ section by the agitated phrases allotted to the singer: ‘Ich bin matt, schwach und beladen’ / ‘I am faint, weak and oppressed.’ Bach helps one to sense in the semiquaver arabesques of the continuo that the soul’s desire for refreshment will be granted—eventually. One could paraphrase the alto recitative (No 4) in contemporary jargon as, ‘Oh my God, I’ve got nothing to wear!’ were it not for the grim conclusion to the parable in Matthew’s Gospel: the guest who arrives without a wedding garment (unprepared, in other words) shall be cast into outer darkness. Dressed appropriately in ‘the robe of righteousness’ the alto and tenor describe their joyful arrival at the feast (No 5) with long vocal melismas and passages, now in close canon, now in parallel thirds and sixths, and animated leaps in the striding continuo line.
BWV49 Ich geh und suche mit Verlangen is a dialogue cantata dating from 1726 in which the obbligato organ performs a concerto-like sinfonia and has a highly decorated part in the opening bass aria and the final love duet between the soul (soprano) and its bridegroom, Christ (bass). All is geared towards creating an atmosphere depicting the beauty of the soul. The language is sensuous, reminiscent of the Song of Songs, its religious outer skin easily penetrated. The first duet section ‘Komm, Schönste, komm’ / ‘Come, fairest, come’ is, as Whittaker says, ‘a frank love-duet which may well take a place on the boards of an Italian opera-house’, appropriately since we were about to perform it in Italy. The best movement is the fourth, an aria for soprano with oboe d’amore and violoncello piccolo, ‘Ich bin herrlich, ich bin schön’, a kind of early version of Bernstein’s ‘I feel pretty’. The religious-erotic mood continues in the long final duet with its highly decorated organ part. The soprano sings verse 7 of Nicolai’s hymn ‘Wie schön leuchtet der Morgenstern’, ending with the phrase ‘I wait for Thee with longing’, to which the bass responds encouragingly, ‘I have always loved you, and so I draw you to me. I’m coming soon. I stand before the door: open up, my abode!’ None of the double entendres is troublesome, only the length of each movement, which slightly outlives its welcome.
Not so with BWV180 Schmücke dich, o liebe Seele, even though the opening movement is very long—one of those relaxed 12/8 processional movements at which Bach excels. Here he combines sustained passages for the wind (two recorders, two oboes, one of them da caccia) with a theme for unison upper strings, then splits off the wind in pairs with cross-rhythmic exchanges over a fragmented (still unison) string figure. The chorale fantasia begins with a serene cantus firmus theme in the sopranos atop decorative lines for the three lower voices perfectly tailored to the idea of the soul dressing itself up in all its wedding finery. Initially it conveys an atmosphere of tenderness and expectation: the getting dressed and the journey to the wedding feast. Suddenly (at bar 71) the tension mounts: the bride has arrived (there is even a hint of her long wedding train in the sustained string chords), a pre-echo of an equivalent intensification in Wachet auf (BWV140, No 1). Its sequel, an aria for tenor with flute obbligato (No 2), strongly redolent of the Badinerie from the B minor Orchestral Suite (BWV1067) only at a slower tempo, suggests a mid-feast entertainment or a dance for pipe and tabor. But instead of the dancing girls comes the injunction to ‘open the door of your heart’ in response to Jesus’ knocking (heard in the repeated quavers in the basso continuo). It is fresh, light-hearted and captivating, and particularly in the Rome concert it inspired a show of spontaneous exuberance from our two keyboard players—boogie rhythms, funky counter-themes, scales, syncopated chords—to me in keeping with the mood of the piece and the occasion, but severely frowned upon by the resident style police.
The wedding feast imagery continues in the third movement, in which the solo soprano leads off in a decorated version of the chorale tune against a gently arpeggiated moto perpetuo for piccolo cello, painting the words ‘Ah, how my spirit hungers! Ah, how often I yearn for that food! Ah, how I thirst for the drink of the Prince of Life!’ Her second aria (No 5) is constructed as a polonaise divided into units of four and six bars, in which one of the two oboes and both of the recorders join with the first violins in shaping the radiant melody. Quite what Bach thought he was doing by adding the soprano to this charming self-contained music one can only wonder. All she does is to sing the same words over and over again (what would Johann Mattheson have had to say!) for twenty bars on end: ‘Sun of Life, Light of the senses, Lord, You who are my all!’ It is one of the few examples of Bach composing a cantata movement as though in his sleep, or at least of paying minimal attention to the word-setting.
The final chorale is a model of its kind, drawing all the strands of the previous movements together—the themes of the heavenly wedding feast, food for the soul and union with God. Johann Franck’s Eucharistic hymn is ineffably tender in Bach’s fourpart harmonisation. As Whittaker says of this cantata, ‘It is one of the most constantly blissful in the series; there are no wars or rumours of wars, no disturbing demons or false prophets, no torture of mind, no thought of past sins, no fear of the hereafter; the soul surrenders herself in ecstasy to the Bridegroom and all things else are forgotten.’
It was fortuitously apt that we were performing these secular-imaged cantatas in two such colourful Italian churches. San Lorenzo in Genoa is a splendid Gothic cathedral striped in polychrome marble like some ecclesiastical zebra. The mix of sacred and profane can hardly be more pronounced than in Rome’s basilica of Santa Maria sopra Minerva, that grandiose thirteenth-century Gothic church squatting on the foundations of three pagan temples—to Isis, to Serapis, and the temple of Minerva built in about 50BC by Pompey the Great. It is a wonderful treasury and jumble of different styles. My favourite is the fifteenth-century tomb of Giovanni Alberini, where a fine Greek sarcophagus of the fifth century BC depicts Hercules fighting the Nemean lion, framed by two Renaissance angels and topped with the cardinal’s full-length recumbent figure. It seems to sum up the stylistic heterogeneity of this magical church.
An estimated four thousand turned up to hear us perform three little-known Bach cantatas. People were sitting on balustrades, squatting in side chapels, standing in all three aisles. I felt a little like a gladiator as I tried to make a path through to the orchestra. The temperature soared. The presence of so many people, so quiet for so long, so attentive and so appreciative, overwhelmed us all. I found it uplifting, conscious throughout of the overlapping layers of pagan and Christian worship and of the dazzling colours that so impressed Handel when he visited Rome. The French cardinal responsible for culture from the Vatican sat immediately behind me in his splendid throne surrounded by listeners. Stepping backwards at one point I inadvertently got a little closer to his lap than I intended, but he didn’t seem to mind. I had been told that I would know when the concert was over by the fact that the cardinal would rise and address a few words to me. This he did in measured ecclesiastical French: ‘Vous avez evoqué les anges par votre musique: ils sont venus avec leur bénédiction. Merci!’ Afterwards somebody asked me why I hadn’t kissed his ring. Now what would the Lutheran pastor of Wittenberg have made of that?
Cantatas for the Twenty-first Sunday after Trinity
Old Royal Naval College Chapel, Greenwich
Returning from Italy, and with an eagerly awaited eastern leg of the pilgrimage to the Baltic States cancelled, we found ourselves back in London and once more in the Old Royal Naval College Chapel, Greenwich, a perfect architectural and acoustic setting. Someone in the group had recently tuned into a German radio station in which a prominent Leipzig Bach scholar and theologian claimed that our BCP was ‘suspect’ on the grounds that Bach himself never performed his cantatas back to back on a single occasion, let alone ‘in a concert’. To do so now, he said, was not merely inauthentic but a guarantee of repetitiousness, since there was an inevitable sameness to Bach’s treatment of the set Gospel and Epistle texts for the same day.
That this is not so one need only turn to the music he wrote for this Sunday. Bach came up with no less than four outstanding works all based on the Gospel account of the healing of the nobleman’s son (John 4: 46-54), marvellously contrasted and subtly differentiated by mood and instrumentation. In the earliest of them, BWV109 Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben!, he sets up a wonderful series of antitheses to articulate the inner conflict between belief and doubt, and the way that faith is granted only after a period of doubt. First, in the fascinating fabric of his opening chorus in D minor, a setting of words from St Mark’s gospel (‘Lord, I believe, help Thou mine unbelief’), he creates a concerto grosso-like division of forces, between concertisten and ripienisten in his terminology (the sources don’t make this division hard and fast, but it emerged during rehearsal from trial-and-error). A mini-trio sonata texture for single violin and either one or two oboes with continuo, or between solo voice, violin and oboe, is juxtaposed with further interjections (marked forte) for the entire concerto grosso forces. The ‘solo’ voices are given the first proposition, ‘Ich glaube, lieber Herr’ (an opening with a rising fourth, capped by the second voice’s rising fifth), while the ‘tutti’ voices chip in with the second: isolated exclamations of ‘hilf’, and then the meandering, downward-tugging phrase ‘hilf meinem Unglauben’. There is endless fascination here in the way these two propositions are articulated, juxtaposed and elaborated in the ever-intensifying exchange between the orchestra and the fugal tapestry woven by all four voices at once. Bach’s setting emphasises the tension between belief and scepticism in such personal terms that one wonders whether it mirrors his own private struggles of faith.
Next come two powerfully intense movements, a recitative and aria for tenor in which this inner struggle is dramatised still further. In the recitative (No 2) Bach reinforces the dichotomy between faith and doubt by assigning two opposing ‘voices’ sung by the same singer, one marked forte, the other piano, alternating phrase by phrase and surely unique in Bach’s recitatives. (How Schumann, would have loved this—he, the creator of Florestan and Eusebius, who hated to express himself in a single unified voice!) The basic struggle is one between B flat major and E minor, keys separated by a tritone. Bach piles on the agony by steering the phrases in these tonally opposite directions, the piano phrases (expressing fear) dragging downwards at first, while the loud protestations of belief tend upwards and sharp-wards. In the final phrase the Eusebian figure seems to lose patience and lets out a slow, earsplitting cry, ‘Ach Herr, wie lange?’, rising to a top A in his despair (marked forte and in tempo adagio) as the continuo plunges down a twelfth to settle on a bottom E, a bleak presage of the aria to come. So far, then, there has been no resolution. God has not answered.
Bach proceeds to paint (No 3) the fearful quivering of the soul by means of jagged melodic shapes, unstable harmonies headed towards anguished second inversion chords, and persistent dotted rhythmic figures. He plunders the tragic reserves of expression inherent in the Lullian French overture to devastating effect, suggesting that this could be interpreted as an early draft of Peter’s aria of remorse from the St John Passion. Like ‘Ach, mein Sinn’ the mood is turbulent, desperate and full of torment. It dwindles in energy in its ‘B’ section, a masterly evocation of the words ‘the wick of faith hardly burns, the almost broken reed now snaps, fear constantly creates fresh pain’. The instrumentation begins to thin, the harmonies veer off course in opposite directions, first to D minor then F sharp minor, away from the tonic E minor, and with an abrupt turning aside from the dominant (B minor) towards A minor just before the full da capo.
At this pivotal point in the cantata, as Eric Chafe maintains, Bach ‘deliberately, I am sure—reverses the relative allegorical meanings of the sharps and flats from the recitative (sharp direction, positive; flat, negative) to the closed movements (flats as positive; sharps as negative)’. So, the next recitative for alto (No 4) turns back to D minor with words of trust in Jesus as a prelude to a sunny aria for alto and two oboes in F major. Constructed as a French passepied, despite the emphasis on the inner conflict between flesh and spirit, it brings with it the first welcome signs of assurance. Now in place of the usual four-part chorale harmonisation Bach concludes with an exuberant fantasia filled with a sense of relief and wellbeing. Beginning in D minor it heads towards A minor, a neutral key that ‘seems to put all the foregoing keys in perspective, an analogue of how faith eventually overcomes doubt’ (Chafe). Whether or not one is inclined to accept such a detailed allegorical interpretation, one thing is certain: Bach’s awareness and sympathy for all the wobbles of belief that many of his listeners, then and now, experience. As Luther insisted, faith is sometimes ‘granted openly, sometimes in secret’. By the end of this cantata you feel you have been well and truly put through the mill.
This theme of the hidden granting of faith recurs in the following year’s cantata, BWV38 Aus tiefer Not schrei ich zu dir, a chorale cantata from 1724 based on Luther’s well-known hymn, in which a free version of Psalm 130 is sung to the ancient Phrygian tune. Luther described this psalm as a cry of a ‘truly penitent heart that is most deeply moved in its distress. We are all in deep and great misery, but we do not feel our condition. Crying is nothing but a strong and earnest longing for God’s grace, which does not arise in a person unless he sees in what depth he is lying.’ Bach understands this perfectly. In an opening chorus only 140 bars long he gives a powerful evocation of this Lutheran crying-from-the-depths and the clamour of imploring voices. He opts for the severe stilo antico or motet-style with each line of the tune presented in long notes by the sopranos and preceded by imitative treatment in the lower voices. He doubles each of the four voices with a trombone—four trombones in a Bach cantata! (one thinks of Schütz and Bruckner). What they bring to the overall mood, besides their unique burnished sonority, is ritual and solemnity. Bach seems intent on pushing the frontiers of this motet movement almost out of stylistic reach through abrupt chromatic twists to this tune in Phrygian mode.
For the third movement, an aria in A minor for tenor with two oboes, Bach’s setting of the lines ‘I hear in the midst of suffering a word of comfort’ takes its cue again from Luther’s commentary which emphasises the ‘blessing’ of ‘contradictory and disharmonious things, for hope and despair are opposites’. We must ‘hope in despair’, for ‘hope which forms the new man, grows in the midst of fear that cuts down the old Adam’. Rarely does Bach write such continuously interwoven chromatic lines for oboes and with almost nowhere to breathe. It demands strong technique and a fearless delivery.
The last three movements are all exceptional, stern and uncompromising: first a soprano recitative marked a battuta over a continuo bass line thundering out the old tune (‘you dare give in to doubts!’, it seemed to be saying), a marvellous reversal of usual practice and a tour de force of its kind, the soprano’s weakened faith scarcely getting a look-in or time to express its frailty. Then a terzetto, twin of the one in BWV116 we performed three Sundays ago in Leipzig—‘Though my despair, like chains, fetters one misfortune to the next, yet shall my Saviour free me suddenly from it all’—which goes on to describe the rise of the ‘morning’ of faith after the ‘night’ of trouble and sorrow. Chains of suspensions precipitate a downward cycle of fifths through the minor keys (d, g, c, f then B flat major), whereas the dawning of faith reverses the direction upwards until the idea of the ‘night’ of doubt and sorrow turns it back again. Different as they seem, these three movements flow from one to the next and seem to call for ‘segue’ treatment. The final low D of the aria is retained as the bass of the final chorale, beginning with an arresting 6/4 chord above it before establishing the new key of E—‘the D, symbol of Trübsal and Nacht, is given new meaning by the change’ (Chafe). As with BWV109, Bach’s strategy delays the provision and granting of help until the last possible moment. With all the voices given full orchestral doubling (again, those four trombones!), this chorale is impressive, terrifying in its Lutheran zeal, especially its final Phrygian cadence with the bass trombone plummeting to bottom E.
Signs and wonders abound in this amazing work. The very word for signs, ‘Zeichen’, is given expressive, symbolic expression—a diminished seventh chord assigned to that word in the soprano recitative, formed by all three ‘signs’, one sharp (F sharp), one flat (E flat) and one natural (C). As Eric Chafe concludes, ‘since St John’s Gospel is known as the Book of Signs, and since the tonal plan of Bach’s St John Passion appears to have been conceived as a form of play on the three musical signs (ie sharp, flat and natural key areas) this important detail in the plan of “Aus tiefer Not” perhaps possesses a wider significance, relating it to Bach’s tonal-allegorical procedures in general.’
After all that accumulated intensity BWV98 Was Gott tut, das ist wohlgetan, dating from November 1726, seems exceptionally genial. It is a considerably shorter and more intimate work than Bach’s other two cantatas based on Samuel Rodigast’s hymn (BWV99 and 100). Although it opens like a chorale cantata it is without the typical concertante exchanges we associate with Bach’s second cycle. Whereas the choral writing expresses confidence in God’s will, taking its cue from the Epistle in which St Paul commands us to ‘put on the whole armour of God’ (Ephesians 6: 10-17), the spotlight is on the first violins. Their melodic material suggests an almost speech-like inflection, a striking way to convey the human vacillations between doubt and trust in God, a technique he could have learnt from many examples of his cousin Johann Christoph Bach’s oeuvre. Whittaker sums up the cantata’s substance with exemplary concision: ‘the tenor pleads for rescue from misery (No 2), the soprano bids her eyes cease from weeping (No 3), since God the Father lives, the alto breathes a message of solace (No 4) and the bass declares (No 5) that he will never leave Jesus.’ Initial surprise that this cantata doesn’t end with a simple chorale but an aria with a chirpy Handelian unison obbligato for the violins gives way to a smile once it becomes clear that the bass’s words are in fact a lightly decorated variant of a chorale by Christian Keymann (1658) to the same words ‘Meinem Jesum lass ich nicht’.
Last in the programme (and the last to be composed) came BWV188 Ich habe meine Zuversicht, of 1728/9. The opening sinfonia derives from the third movement of the D minor harpsichord concerto BWV1052, of which only the last 45 bars exist in the autograph score. Robert Levin reconstructed the lost 248 bars with characteristic panache. The result is hugely exhilarating. The opening aria is one of the most satisfying of all Bach’s tenor arias: pastoral in mood in its ‘A’ section, with the emphasis on Hoffnung (hope), and aspiring to Zuversicht (trust or confidence in God) rather than asserting it, as the vehement and dramatic ‘B’ section makes clear. It is also singer-friendly, a rarity in Bach’s arias for tenor. A long and distinguished bass recitative, ending with a 6/8 arioso, separates this from the alto aria (No 4), presumably an instrumental movement given to organ obbligato with a voice part added. The final chorale, ‘Auf meinen lieben Gott’, has a tune secular in origin associated with Venus, goddess of love. In Bach’s harmonisation it exudes confidence, trust and power.
The Old Royal Naval College Chapel provided a sympathetic setting for these cantatas, though since we were last here in January the Health and Safety people had got their claws into the place, creating unnecessary bureaucratic and physical obstacles, such as ‘emergency pathways’ for us to dodge around. The audience was genuinely appreciative, but oh-so-English, too shy or deferential to show any of the spontaneous exuberance or enthusiasm of their continental counterparts, their polite applause dropping short each time like a deflated balloon.
Sir John Eliot Gardiner © 2010
from a journal written in the course of the Bach Cantata Pilgrimage
La lecture de l’Évangile en ce vingtième dimanche après la Trinité est la parabole du festin des noces royales (Matthieu 22, 1-14). Elle fait surgir nombre de références imagées à l’âme en tant que fiancée, au voyage, au vêtement et à la nourriture—notamment à Jésus perçu tel le «pain de vie», dont Bach se fit l’écho dans trois Cantates, toutes marquées, à leur manière, par cette imagerie, chacune recréant un climat sensuel individualisé par le biais de l’instrumentation, de l’écriture vocale, d’une sonorité particulière ou d’un mélange des trois.
Vint tout d’abord une Cantate composée en 1716 pour la cour de Weimar, reprise, transposée et recopiée à Leipzig en 1723. Le livret solidement tourné de Salomo Franck pour Ach! ich sehe, itzt, da ich zur Hochzeit gehe («Ah! je vois, maintenant que je vais au mariage»), BWV162, compare la vie à un périple menant au festin des noces. Le résultat—bonheur ou infortune—dépend en partie de la compagnie que l’on se choisit, en partie également, en tant que convive des noces, de la manière dont on sait se montrer digne de l’invitation. Franck ayant une prédilection pour les combinaisons poétiques et l’opposition des contraires, on trouve dans l’air initial de basse des références tant au Seelengift («poison de l’âme») qu’au Lebensbrot («pain de vie»), au ciel et à l’enfer, à la vie et à la mort, aux rayons du ciel et aux feux de l’enfer. C’est là un mariage pour le moins singulier—nulle surprise à ce que l’ultime vers soit «Jésus, aide-moi à tenir bon!». Avec ses violons et hautbois se répondant par chœurs (tout d’abord en canon) et une partie inhabituelle pour corno da tirarsi (jouée ici par un trombone alto), la musique de Bach est de caractère solennel, sur une structure de type Fortspinnung reposant sur un ritornello et avec une série de répétitions. Le «voyage» se poursuit dans l’air de soprano, «Jesu, Brunnquell aller Gnade» («Jésus, source de toute grâce», nº 3), dans lequel le rafraîchissement apporté par l’eau au «pitoyable convive» est évoqué par le mètre à 12/8 et les parties obligées de flûte et de hautbois d’amour, reconstituées à notre intention par Robert Levin. Sérénité du climat et fluidité des lignes sont bousculées dans la section B par les phrases agitées dévolues à la voix: «Ich bin matt, schwach und beladen» («Je suis épuisée, faible et accablée»). Bach nous laisse entendre dans les arabesques en doubles croches du continuo que le désir de fraîcheur de l’âme sera finalement pris en considération. L’on pourrait paraphraser le récitatif d’alto (nº 4) à travers un jargon plus contemporain—«Mon Dieu! je n’ai rien à me mettre!»—si ce n’était la sinistre conclusion de la parabole de l’Évangile de Matthieu: le convive qui arrive sans tenue de noces (autrement dit sans préparation) sera rejeté et damné. Ayant revêtu, comme il convient, les «habits de la droiture», alto et ténor décrivirent leur joyeuse arrivée au festin (nº 5) en de longs mélismes vocaux et traits ornementaux, tantôt en canon serré, tantôt en tierces et sixtes parallèles, sous-tendus de sauts dans une partie de continuo progressant à grandes enjambées.
La Cantate Ich geh und suche mit Verlangen («Je vais et cherche en te réclamant»), BWV49, est un «dialogus» de 1726 dans lequel l’orgue obbligato se voit confier, outre une sinfonia de type concerto, une partie hautement décorative dans l’air de basse initial et dans le duo d’amour de conclusion entre l’âme (soprano) et le Christ son promis (basse). Tout ici est fait pour créer une atmosphère reflétant la beauté de l’âme. Le langage en est sensuel, réminiscence du Cantique des Cantiques, son enveloppe religieuse extérieure se laissant aisément pénétrer. La première section en duo, «Komm, Schönste, komm» («Viens, [toi] la plus belle, viens»), est selon l’expression de Whittaker «un transparent duo d’amour qui aurait tout aussi bien pu être chanté sur les planches d’un théâtre d’opéra italien»—ce qui ne pouvait mieux tomber pour nous qui allions justement l’interpréter en Italie. Le quatrième mouvement, un air pour soprano avec hautbois d’amour et violoncello piccolo, est le plus achevé: «Ich bin herrlich, ich bin schön» («Je suis splendide, je suis belle»), sorte d’anticipation du I feel pretty de Bernstein. Ce climat érotico-religieux se poursuit dans le long duo final, avec sa partie d’orgue extrêmement ornementée. Le soprano chante la septième strophe de l’hymne de Nicolai «Wie schön leuchtet der Morgenstern» («Comme elle resplendit, l’étoile du matin!», 1599), concluant sur cette phrase: «Je T’attends en soupirant»—à quoi la basse répond, en manière d’encouragement: «Je t’ai toujours aimée, c’est pourquoi je te prends avec moi. Je vais arriver. Je suis devant la porte, ouvre-moi, ma demeure!». Ce ne sont pas ici les doubles sens qui posent problème, mais plutôt la longueur de chaque mouvement, celle-ci finissant par lasser quelque peu.
Il en va différemment de la Cantate Schmücke dich, o liebe Seele («Pare-toi, ô chère âme»), BWV180, bien que le mouvement d’introduction en soit très développé—c’est l’un de ces mouvements, telle une procession simplement allante et détendue, à 12/8, dans lesquels Bach excelle. Aux passages ornementés pour les vents (deux flûtes à bec et deux hautbois, dont un da caccia), Bach associe le thème des cordes supérieures à l’unisson, puis il scinde les vents par paires, avec échanges en rythmes croisés sur une figure de cordes fragmentée (bien que toujours à l’unisson). La fantaisie de choral s’ouvre sur un thème serein aux sopranos, cantus firmus surplombant les lignes décoratives des trois parties vocales inférieures, parfaitement adapté à cette idée de l’âme revêtant ses atours de noces. Il en résulte de prime abord un climat de tendresse et d’attente: le temps de l’habillage et du voyage jusqu’au festin des noces. Soudain (mes. 71) la tension monte: la fiancée est arrivée (il y a même une évocation de sa longue traîne dans les accords soutenus des cordes), préécho d’une intensification similaire dans Wachet auf (BWV140, nº 1). L’air qui s’ensuit—page pour ténor avec flûte obligée (nº 2) rappelant fortement la Badinerie de la Suite en si mineur pour orchestre (BWV1067) mais sur un tempo plus lent—suggère un divertissement à mi-fête ou une danse pour chalumeau et tambourin. Mais au lieu de jeunes filles en train de danser survient cette exhortation: «ouvre vite la porte de ton cœur», en réponse à Jésus frappant à la porte (entendu dans les croches répétées de la basse continue). Cet air tout de fraîcheur, enjoué et plein de charme, inspira à nos deux claviéristes, en particulier lors du concert de Rome, une démonstration d’exubérance spontanée—rythmes de danse, contre-thèmes funky, gammes, accords syncopés—pour moi en parfait accord avec l’esprit de la pièce et son contexte, mais qui fit sévèrement froncer les sourcils des gardiens locaux du style.
L’imagerie du festin de noces se maintient dans le troisième mouvement: commençant sur une version ornementée de la mélodie de choral au-dessus d’un moto perpetuo délicatement arpégé au violoncello piccolo, le soprano solo énonce les paroles suivantes: «Ah! comme mon esprit a faim, Ami des humains, de ta bonté! Ah! combien de fois ai-je en larmes désiré cette nourriture! Ah! combien ai-je voulu me désaltérer de la boisson du Prince de Vie!». Son second air (nº 5) est construit telle une polonaise subdivisée en unités de quatre et six mesures, l’un des deux hautbois et les deux flûtes à bec se joignant aux premiers violons pour en dessiner la radieuse mélodie. Difficile de ne pas se demander ce que Bach avait précisément en tête en ajoutant le soprano. Tout ce que fait ce dernier, c’est chanter encore et toujours les mêmes paroles (on imagine ce qu’un Johann Mattheson aurait trouvé à redire!) pendant vingt mesures, terminant sur: «Soleil de la vie, lumière des sens / Seigneur, toi qui es tout pour moi!». C’est l’un des rares exemples de Bach composant un mouvement de cantate comme en somnolant, ou du moins en ne témoignant qu’un minimum d’attention à l’adéquation paroles-musique.
Le choral de conclusion est un modèle du genre, tous les fils des mouvements précédents s’y trouvant noués—thèmes du festin céleste des noces, nourriture de l’âme et union avec Dieu. L’hymne eucharistique de Johann Franck est d’une ineffable tendresse dans l’harmonisation à quatre voix de Bach. À propos de cette Cantate, Whittaker fait remarquer que «c’est l’une des plus continûment heureuses de la série; on n’y trouve ni guerres ni bruits de guerre, pas de démons perturbateurs ou de faux prophètes, pas de torture de l’esprit, aucune évocation des péchés antérieurs, nulle crainte de ce qui doit advenir: l’âme d’elle-même se livre, extatique, au jeune époux et tout le reste est oublié.»
Ce fut avec un bel à-propos que le hasard nous fit chanter ces Cantates à l’imagerie séculière dans deux églises italiennes aussi hautes en couleur. San Lorenzo de Gênes est une splendide cathédrale gothique aux rayures de marbres polychromes, sorte de zèbre ecclésiastique. Le mélange de sacré et de profane saurait difficilement être plus prononcé que dans la basilique romaine de Santa Maria sopra Minerva, grandiose église gothique du XIIIe siècle prenant appui sur les fondations de trois temples païens—temples d’Isis et de Sérapis, temple de Minerve érigé vers 50 av. J.-C. par Pompée le Grand. C’est un trésor merveilleux en forme d’accumulation de styles. J’ai un faible pour la tombe du XVe siècle de Giovanni Alberini, dont le sarcophage grec du Ve siècle avant Jésus-Christ représente le combat d’Hercule contre le lion de Némée, entouré de deux anges Renaissance et couronné du gisant, grandeur nature, du cardinal. Ce tombeau semble à lui seul résumer toute l’hétérogénéité stylistique de cette prodigieuse église.
Une assistance estimée à quatre mille personnes était venue nous écouter interpréter trois Cantates peu connues de Bach. Les gens étaient assis sur les balustrades, accroupis dans les chapelles latérales, debout dans chacune des trois nefs. Je me suis un peu senti tel un gladiateur en essayant de me frayer un chemin vers l’orchestre. La température montait. La présence de tant de gens, restés si longtemps silencieux, si attentifs et reconnaissants, nous bouleversait. Je la trouvai stimulante, gardant d’un bout à l’autre à l’esprit cet enchevêtrement de strates d’adoration, païennes et chrétiennes, et ces couleurs éblouissantes qui avaient tant impressionné Haendel durant son séjour romain. Sur son trône magnifique, entouré d’auditeurs, le cardinal français en charge de la culture au Vatican était assis juste derrière moi. À un moment donné, je reculai et me retrouvai par inadvertance un peu plus près de ses genoux que je ne l’aurais voulu, mais il ne sembla pas s’en formaliser. Je saurais, m’avait-on dit, que le concert était terminé quand le cardinal, se levant, viendrait me dire quelques mots. Ce qu’il fit en un français d’église tout de mesure: «Vous avez évoqué les anges par votre musique: ils sont venus avec leur bénédiction. Merci!» Après coup, quelqu’un m’a demandé pourquoi je n’avais pas baisé son anneau. Je me demande bien ce que le pasteur de Wittenberg en aurait alors pensé !
Cantates pour le vingt-et-unième dimanche après la Trinité
Old Royal Naval College Chapel, Greenwich
Revenant d’Italie, alors que l’étape de notre pèlerinage dans les Pays baltes, attendue avec impatience, venait d’être annulée, nous nous retrouvâmes à Londres et, une fois encore, à l’Old Royal Naval College Chapel de Greenwich, cadre parfait tant sur le plan architectural qu’acoustique. Quelqu’un de notre groupe avait récemment entendu, s’étant connecté sur une station de radio allemande, un éminent spécialiste de Bach et théologien de Leipzig déclarer que notre Bach Cantata Pilgrimage était «suspect» du simple fait que Bach lui-même n’avait jamais fait entendre ses Cantates côte à côte, en une seule et même occasion, sans même parler d’«un seul et même concert». Procéder de la sorte aujourd’hui était, selon lui, non seulement inauthentique mais aussi une assurance de répétitivité, du fait qu’il y avait chez Bach une inévitable uniformité dans le traitement musical des textes de l’Évangile et de l’Épître d’un même jour.
Pour se convaincre qu’il n’en est rien, il suffit de se tourner vers la musique qu’il écrivit pour ce vingt-et-unième dimanche. Bach a en effet livré pas moins de quatre œuvres remarquables, toutes reposant sur le récit évangélique de la guérison du fils du fonctionnaire royal (Jean, 4, 46-54), merveilleusement contrastées et subtilement différenciées par le climat et l’instrumentation. Dans la plus ancienne d’entre elles, Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben! («Je crois, cher Seigneur, aide mon incroyance»), BWV109, il met en œuvre une magnifique série d’antithèses pour restituer le conflit interne entre foi et doute, également le fait que la foi n’est accordée qu’après une période de doute. Tout d’abord, à travers la fascinante élaboration du chœur d’introduction en ré mineur mettant en musique des paroles empruntées à l’Évangile de Marc, il organise une division des forces dans l’esprit du concerto grosso, opposant, selon sa propre terminologie, concertisten et ripienisten (les sources ne présentent pas cette division de manière absolue, mais celle-ci s’est imposée au cours des répétitions par approximations successives). Une texture de mini-sonate en trio pour violon solo et soit l’un des hautbois soit les deux et continuo, ou bien pour voix soliste, violon et hautbois, se trouve juxtaposée à d’autres interjections (indiquées forte) émanant de l’ensemble des forces du concerto grosso. Aux voix «solistes» revient à tour de rôle la proposition initiale: «Ich glaube, lieber Herr» (ouverture sur quarte ascendante, coiffée de la quinte ascendante de la seconde voix), tandis que les voix du tutti rejoignent par bribes la seconde: exclamations isolées sur «hilf», puis sur la phrase sinueuse, comme poussée malgré elle vers le bas, «hilf meinem Unglauben». De la manière dont ces deux propositions se trouvent ici articulées, juxtaposées et élaborées au gré de l’échange, d’une intensité croissante, entre l’orchestre et l’entrelacs fugué tissé par les quatre voix à la fois, résulte une inépuisable fascination. L’adaptation de Bach amplifie la tension entre foi et scepticisme en des termes si personnels que l’on finit par se demander s’il ne faudrait pas y voir un reflet de son propre combat s’agissant de la foi.
Vient ensuite un double mouvement d’une puissante intensité, récitatif & air pour ténor au cours duquel la dramatisation de cette lutte intérieure est menée plus avant. Dans le récitatif (nº 2), Bach renforce la dichotomie entre foi et doute en confiant au même chanteur deux «voix» opposées, l’une indiquée forte, l’autre piano, alternance, phrase après phrase, sans doute unique dans les récitatifs de Bach. (Comme Schumann aurait aimé cela—lui, le créateur de Florestan et Eusebius, qui détestait s’exprimer à travers une seule voix, unifiée!) La lutte fondamentale se traduit ici par l’opposition de si bémol majeur et de mi mineur, tonalités a intervalle de triton. Bach renforce cet affrontement en orientant les phrases dans des directions opposées—les phrases piano (qui expriment la crainte) étant tout d’abord entraînées vers le bas cependant que les retentissantes protestations de foi semblent pousser vers le haut, comme tentées de rajouter des dièses. Dans l’ultime phrase, la figure façon Eusebius semble perdre patience et laisse échapper un cri lent et strident—«Ach Herr, wie lange?» («Ah!, Seigneur, combien de temps?»), se hissant dans son désespoir jusqu’à un la aigu (marqué forte sur tempo adagio) tandis que le continuo plonge d’une douzième vers le bas, jusqu’à un mi grave, sombre anticipation de l’air à venir. À ce stade, aucune résolution n’est encore apparue. Dieu n’a pas répondu.
Bach poursuit en retraçant (nº 3) le frissonnement inquiet de l’âme au moyen de motifs mélodiques déchiquetés, d’harmonies instables tendant vers des accords angoissés à l’état de deuxième renversement, de figures rythmiques pointées et persistantes. Il met à profit, de manière incomparable, la moindre composante expressive et tragique inhérente à l’ouverture à la française selon Lully—l’on pourrait y voir une première ébauche de l’air du remords de Pierre dans la Passion selon saint Jean. À l’instar de l’air de ténor «Ach, mein Sinn», le climat y est agité, désespéré, tourmenté. L’énergie déployée diminue dans sa section B, magistrale adaptation des paroles «la mèche de la foi peine à éclairer devant elle / le jonc ployé en vient à se briser / la crainte sans cesse crée une douleur nouvelle.» Peu à peu l’instrumentation s’amoindrit, les harmonies bifurquant dans des directions opposées, d’abord ré mineur puis fa dièse mineur, loin de la tonique mi mineur, puis, se détournant brusquement de la dominante (si mineur), vers la mineur juste avant un complet da capo.
Arrivé à ce tournant crucial de la Cantate, ainsi qu’Eric Chafe l’affirme, Bach «délibérément, j’en suis certain, renverse la signification allégorique des dièses et bémols du récitatif (le sens des dièses étant positif, celui des bémols négatif) dans les mouvements de conclusion (les bémols devenant positifs, les dièses négatifs)». Moyennant quoi le récitatif suivant, pour alto (nº 4), s’en revient au ton de ré mineur sur des paroles de confiance en Jésus, prélude à l’air radieux pour alto et deux hautbois en fa majeur. Construit tel un passepied français, et en dépit de l’accent mis sur le conflit intérieur entre chair et esprit, il apporte avec lui les premiers et bienvenus signes d’assurance. En lieu et place de l’habituel choral harmonisé à quatre parties, voici que Bach conclut sur une exubérante fantaisie tout animée d’un sentiment de soulagement et de bien-être. Commençant en ré mineur, il s’oriente vers la mineur, tonalité neutre qui «semble mettre en perspective toutes les tonalités antérieures, par analogie à la manière dont la foi finit par l’emporter sur le doute» (Chafe). Que l’on soit disposé ou non à faire sienne dans le détail une telle interprétation allégorique, une chose est certaine: la conscience qu’a Bach, et la sympathie qu’il ressent, de ces fluctuations de la foi éprouvées, alors comme maintenant, par nombre de ses auditeurs. Et Luther d’insister: la foi est parfois «ouvertement accordée, parfois en secret». À la fin de cette Cantate, on a le sentiment d’être bel et bien passé par de rudes épreuves.
Ce thème de l’octroi caché de la foi reparut dans la Cantate-choral de l’année suivante (1724), Aus tiefer Not schrei ich zu dir («De fond de la détresse je crie vers toi»), BWV38, laquelle repose sur l’hymne bien connue de Luther et fait entendre une libre adaptation du Psaume 130 [De profundis clamavi] chantée sur la vénérable mélodie en mode phrygien. Luther décrit ce psaume tel le cri d’un «cœur véritablement repenti bouleversé au plus profond de sa détresse. Nous sommes tous dans une profonde et grande misère, mais nous ne ressentons notre condition. Crier n’est rien d’autre qu’un puissant et impérieux désir de la grâce de Dieu, laquelle ne se manifeste en l’être avant qu’Il n’ait vu dans quel abîme celui-ci gît.» Ce que Bach entend à la perfection. Dans un chœur d’introduction de seulement 140 mesures, il offre une puissante évocation de ce «cri depuis les profondeurs» luthérien et de la clameur des voix implorantes. Il opte pour le sévère stilo antico, façon motet, chaque ligne de la mélodie étant présentée en valeurs longues par les sopranos et précédée d’un traitement en imitation des voix inférieures. Il double chacune des quatre voix d’un trombone—quatre trombones dans une Cantate de Bach! (on songe à Schütz ou à Bruckner). Ce qu’ils apportent au climat général, outre leur incomparable et éclatante sonorité, relève du rituel et de la solennité. Bach semble vouloir pousser les limites de ce mouvement de forme motet presque hors de portée stylistique via les distorsions chromatiques abruptes de cette mélodie en mode phrygien.
Pour le troisième mouvement, un air en la mineur pour ténor et deux hautbois, la manière dont Bach met en musique les vers «J’entends au milieu de la souffrance / un mot de réconfort […]» trouve de nouveau sa source dans le commentaire de Luther mettant en exergue la «bénédiction» de «choses contradictoires et disharmonieuses, car espoir et désespoir sont à l’opposé l’un de l’autre». Nous devons «espérer dans le désespoir», car «l’espoir qui forme l’homme nouveau, croît au milieu de la peur qui abat le vieil Adam». Il est rare que Bach écrive de telles lignes chromatiques de hautbois, si continûment imbriquées et sans presque d’endroits pour respirer. Il y faut une technique aguerrie et un jeu intrépide.
Les trois derniers mouvements sont tous exceptionnels, sévères et sans compromis. Vient tout d’abord un récitatif pour soprano indiqué a battuta sur une ligne de basse continue faisant puissamment retentir la vieille mélodie («tu oses t’abandonner au doute!», semblait-elle vouloir dire), merveilleux renversement de ce qui se fait habituellement et tour de force en son genre, la foi affaiblie du soprano n’ayant nulle occasion, ou le temps pour cela, d’exprimer sa fragilité. S’ensuit un terzetto, jumeau de celui de la Cantate BWV116 que nous avions donnée trois dimanches plus tôt à Leipzig—«Si mon affliction [Trübsal], comme avec des chaînes, fait qu’un malheur en suit un autre, mon salut cependant m’obtiendra que de tout soudainement je sois libéré»—lequel décrit «combien vite paraîtra le matin du réconfort / après cette nuit [Nacht] de détresse et de tourment!». Une série de suspensions précipite un cycle descendant des quintes par les tons mineurs (ré, sol, do, fa—puis si bémol majeur), tandis que l’aube de la foi renverse la direction, ascendante jusqu’à ce que l’idée de la «nuit» de doute et de tourment ne l’inverse à nouveau. Aussi différents puissent-ils sembler, ces trois mouvements s’enchaînent l’un à l’autre, semblant réclamer un traitement de type segue. Le ré grave final de l’air se maintient dans le choral de conclusion, lequel débute sur un saisissant accord à 6/4 reposant sur cette note avant d’instaurer la nouvelle tonalité de mi—«le ré, qui symbolise Trübsal et Nacht, trouve une signification renouvelée par ce changement» (Chafe). À l’instar de la Cantate BWV109, la stratégie de Bach consiste à différer fourniture et octroi de l’aide aussi longtemps que possible. Avec toutes les voix doublées par l’orchestre au complet (de nouveau les quatre trombones!), ce choral en impose, jusqu’à sembler terrifiant de zèle luthérien, en particulier son ultime cadence, en mode phrygien, tandis que le trombone basse se laisse tomber sur le mi grave.
«Signes et miracles» abondent dans cette œuvre étonnante. Du mot lui-même pour signes, «Zeichen», émane une dimension expressive et symbolique—ce mot est sous-tendu d’un accord de septième diminuée dans le récitatif du soprano, constitué de chacun des trois «signes», un dièse (fa dièse), un bémol (mi bémol) et une note naturelle (do). Eric Chafe en conclut que, «l’Évangile de saint Jean [Partie I, 1 à 12] étant aussi dénommé Livre des Signes, et dans la mesure où le plan tonal de la Passion selon saint Jean de Bach semble avoir été conçu tel un jeu sur les trois signes musicaux (régions tonales dans l’ordre des dièses, des bémols ou naturelles), il se peut que ce détail important du plan de «Aus tiefer Not» revête une signification plus large, le rattachant aux procédés à la fois tonals et allégoriques de Bach en général ».
Après toute cette intensité accumulée, la Cantate Was Gott tut, das ist wohlgetan («Ce que Dieu fait est bien fait»), BWV98, datée de novembre 1726, semble exceptionnellement affable. Il s’agit d’une œuvre infiniment plus courte et plus intimiste que les deux autres Cantates de Bach reposant sur l’hymne (1674) de Samuel Rodigast (BWV99 et 100). Si elle s’ouvre à la manière d’une cantate-choral, c’est toutefois sans les échanges caractéristiques de type concertante que l’on associe au deuxième cycle de Bach. Tandis que l’écriture chorale exprime la confiance dans la volonté de Dieu, puisant à la source de l’Épître dans laquelle saint Paul (Éphésiens, 6, 10-17) nous enjoint de «revêtir l’armure de Dieu» [verset 11], les premiers violons sont en première ligne. Leur matériau mélodique suggère une inflexion se rapprochant presque du discours parlé, façon saisissante de restituer les humaines tergiversations entre doute et confiance en Dieu, technique qu’il pourrait avoir apprise à travers maints exemples dans l’œuvre de son cousin Johann Christoph Bach. Whittaker résume la substance de cette Cantate avec une exemplaire concision: «le ténor implore d’être sauvé de la misère (nº 2), le soprano demande à ses yeux de cesser de pleurer (nº 3), puisque Dieu le Père vit, l’alto donne libre cours à un message de consolation (nº 4) et la basse déclare (nº 5) que jamais elle ne quittera Jésus». La surprise initiale—celle de voir cette Cantate se refermer non sur un simple choral mais sur un air soustendu d’un obbligato enjoué des violons à l’unisson—cède la place à un sourire lorsqu’il apparaît clairement que les paroles de la basse ne sont en fait qu’une variante légèrement ornementée d’un choral (1685) de Christian Keymann sur les mêmes paroles, «Meinem Jesum lass ich nicht».
La dernière œuvre de notre programme (et la dernière composée, 1728-1729) était la Cantate Ich habe meine Zuversicht («J’ai ma confiance»), BWV188. La Sinfonia d’introduction provient du troisième mouvement du Concerto pour clavecin en ré mineur BWV1052, dont seules les dernières quarante-cinq mesures sont conservées dans la partition autographe. Robert Levin a reconstitué les deux cent quarante huit mesures perdues avec un panache bien dans sa manière. Le résultat en est particulièrement enthousiasmant. Le premier air est l’un des plus gratifiants de Bach pour ténor: de caractère pastoral dans sa section A, l’accent étant mis sur «Hoffnung» (espoir), et aspirant à la «Zuversicht» (assurance ou confiance en Dieu), à défaut de la proclamer, ainsi que sa véhémente et dramatique section B l’indique clairement. Il se révèle également bienveillant envers le soliste, une rareté dans les airs pour ténor de Bach. Un long et élégant récitatif de basse, finissant en arioso à 6/8, le sépare de l’air d’alto (nº 4), probablement un mouvement instrumental octroyé à l’orgue obbligato avec ajout d’une partie vocale. La mélodie du choral de conclusion, «Auf meinen lieben Gott», témoigne d’une origine profane en lien avec Vénus, déesse de l’amour. Dans l’harmonisation de Bach, il respire confiance, assurance et énergie.
L’Old Royal Naval College Chapel constituait pour ces Cantates un cadre des plus avenants, même si depuis notre dernier passage en janvier les Services de Santé et de Sécurité avaient mis le grappin sur les lieux, créant nombre d’obstacles inutiles, bureaucratiques et physiques, tels ces «couloirs d’urgence» qu’il nous fallait éviter. Le public se montra sincèrement admiratif et reconnaissant mais ô combien britannique, trop timoré ou respectueux pour s’abandonner à l’exubérance ou à l’enthousiasme spontanés de leurs homologues du continent, leurs applaudissements polis tournant chaque fois court tel un ballon dégonflé.
Sir John Eliot Gardiner © 2010
d'après le journal tenu durant le «Bach Cantata Pilgrimage»
Français: Michel Roubinet
Unsere wöchentlichen Vorbereitungen auf die Aufführung dieser einzigartigen Werke, ein Arbeitsrhythmus, den wir ein ganzes Jahr lang beibehielten, waren von verschiedenen Faktoren beeinflusst: Zeit (nie genug), Geographie (zunächst Spurensuche auf den Wegen Bachs in Thüringen und Sachsen), Architektur (die Kirchen, berühmte und weniger bekannte, in denen wir auftraten), der Einfluss der Musik einer Woche auf die nächste und die verschiedenen Veränderungen unter den Mitwirkenden, wenn Spieler und Sänger sich neu oder erneut der Pilgerreise anschlossen, und zwangsläufig auch die Unwägbarkeiten des Wetters, der Reise und unsere Müdigkeit. Wir sahen uns jede Woche neuen Herausforderungen gegenüber, und jede Woche bemühten wir uns, sie zu bewältigen, den Blick auf die praktische wie auf die theoretische Seite gerichtet. Zuweilen mussten wir Kompromisse eingehen, um den Launen des Kirchenjahres zu begegnen (Ostern fiel 2000 ungewöhnlich spät, und das bedeutete, dass für die Kantaten der späten Sonntage nach Trinitatis der Platz knapp wurde und sie in anderen Programmen untergebracht werden mussten). Und wenn wir an einem Abend Kantaten gemeinsam aufführen wollten, die Bach über einen Zeitraum von über vierzig Jahren für den gleichen Tag komponiert hatte, mussten wir uns bei jedem Programm für einen einzigen Stimmton (A = 415) entscheiden, weshalb die frühen Weimarer Kantaten, die den hohen Orgelton zugrunde legten, in der transponierten Fassung aufzuführen waren, die Bach für ihre—tatsächliche oder vermeintliche—Wiederaufführung in Leipzig vorgesehen hatte. Obwohl wir Reinhold Kubik mit einer neuen Edition der Kantaten beauftragt hatten, in der die jüngsten Quellenfunde berücksichtigt wurden, blieben hinsichtlich Instrumentierung, Tonlage, Bass figuration, Stimmtypen, Textzuordnung usw. noch viele praktische Entscheidungen zu treffen. Auch den Luxus wiederholter Aufführungen, in denen wir verschiedene Lösungen hätten ausprobieren können, hatten wir nicht. Kaum war ein Feiertag vorbei, rückten die drei oder vier Kantaten, die wir aufgeführt hatten, in den Hintergrund, und schon hatten uns die nächsten im Griff—was in der Zeit um die hohen Feiertage wie Pfingsten, Weihnachten und Ostern ins Uferlose geriet.
Die Aufnahmen in dieser Folge sind ein Nebenprodukt der Konzerte, nicht ihre raison d’être. Sie sind getreue Dokumente der Pilgerreise, waren jedoch nie als endgültige stilistische oder musik wissenschaftliche Statements gedacht. Jedem der Konzerte, die wir aufgenommen haben, war ein „Take“ der Generalprobe in der leeren Kirche voraus gegangen, das uns gegen Störfaktoren wie Außenlärm, lautes Husten, Zwischenfälle oder wettermäßige Beeinträchtigungen während der Aufführung rückversichern sollte. Aber die Musik dieser Einspielungen ist insofern sehr „live“, als sie genau wiedergibt, was an dem betreffenden Abend vor sich ging, wie die Ausführenden auf die Musik ansprachen (die für sie zuweilen vollkommen neu war) und wie der jeweilige Ort, wo sich die Kirche befand, und das Publikum unsere Reaktionen beeinflussten. Diese Serie ist eine Würdigung der erstaunlichen Musikalität und des Talentes aller beteiligten Spieler und Sänger und natürlich des Genies J. S. Bachs.
Kantaten für den Zwanzigsten Sonntag nach Trinitatis
San Lorenzo, Genua
Nachdem wir das nüchterne Wittenberg mit seinen feurigen Feiern zum Reformationsfest hinter uns gelassen hatten, während uns die Abschiedsworte des Pfarrers („Führen Sie die gute Tat in Rom fort!“) noch in den Ohren klangen, ging die Reise nach Italien—zuerst nach Genua und dann weiter nach Rom, wo Luthers Antichrist seinen Sitz hatte. Johannes Paul II. hatte unlängst zwei päpstliche Bullen veröffentlicht, eine, die jede Aufführung nicht-geistlicher Musik in den Kirchen verbot, und, als sich herausstellte, dass sich das nicht so genau definieren ließ, gleich eine zweite, die überhaupt alle Konzerte in Kirchen untersagte. Zum Glück gibt es immer noch ein paar „regimekritische“ katholische Priester und sogar Kardinäle, die der Musik zugetan und bereit sind, solch eine Vorschrift aufzuweichen—mit dem erfreulichen Ergebnis, dass wir zwei Konzerte geben durften, das eine in der Kathedrale San Lorenzo in Genua und das andere am folgenden Tag in der Basilika Santa Maria sopra Minerva in Rom.
Das Evangelium für den Zwanzigsten Sonntag nach Trinitatis, das Gleichnis vom königlichen Hochzeitsmahl (Matthäus 22, 1-14), legt viele symbolische Bezüge nahe: auf die Seele als Braut, eine zurückzulegende Wegstrecke, Kleidung und Speise, zum Beispiel Jesus als „Brot des Lebens“. Bach schuf drei Vertonungen, die auf ihre Weise alle von dieser Symbolik geprägt sind und durch ihre Instrumentation, ihren Vokalsatz, ihren besonderen Klang oder eine Mischung aus allen drei Elementen eine jeweils andere Atmosphäre schaffen.
Zuerst entstand eine Kantate, die Bach 1716 für den Weimarer Hof schrieb, 1723 in Leipzig wiederaufführte, transponierte und noch einmal kopierte. Salomo Francks mit deutlichen Worten formuliertes Libretto zu BWV162 Ach! ich sehe, itzt, da ich zur Hochzeit gehe vergleicht das Leben mit dem Weg zu einem Hochzeitsfest. Das Ergebnis—Glück oder Leid—ist einerseits davon abhängig, in wessen Gesellschaft man sich dorthin begibt, und andererseits, ob man sich als Hochzeitsgast der Einladung würdig erweist. Franck liebt poetische Verknüpfungen und krasse Gegensätze, so verweist er zum Beispiel in der einleitenden Bass-Arie auf „Seelengift und Lebensbrot“, „Himmel, Hölle, Leben, Tod“, „Himmelsglanz und Höllenflammen“. Eine absonderliche Hochzeit! Kein Wunder, dass die letzte Zeile lautet: „Jesu, hilf, dass ich bestehe!“ Durch die antiphonisch eingesetzten Violinen und Oboen (ursprünglich im Kanon) und einen ungewöhnlichen Part für ein Corno da tirarsi (hier von einer Altposaune übernommen) wirkt Bachs Musik feierlich in ihrer Stimmung, ihre dem Fortspinnungstypus folgende Form basiert auf einem Ritornell mit sequenzierten Wiederholungen. Die „Reise“ wird in der Sopran-Arie „Jesu, Brunnquell aller Gnaden“ (Nr. 3) fortgesetzt, wo ein 12/8-Takt und obligate Linien für Flöte und Oboe d’amore, die Robert Levin für uns rekonstruiert hat, auf die Erquickung durch kühlendes Wasser am Wegesrand verweisen. Die beschauliche Stimmung mit ihren fließenden Linien wird im „B“-Teil durch die erregten Phrasen der Singstimme gestört: „Ich bin matt, schwach und beladen“. Bach lässt uns durch die Arabesken der Sechzehntel ahnen, dass der Hunger der Seele nach Erquickung letzten Endes gestillt werden wird. Der Text des Alt-Rezitativs (Nr. 4) könnte auf moderne Weise formuliert lauten: „O mein Gott, ich hab nichts anzuziehen!“, wäre da nicht der grausige Schluss des Gleichnisses: Der Gast, der nicht im Hochzeitskleid erscheint (unvorbereitet mit anderen Worten), wird in die Finsternis hinausgeworfen. Alt und Tenor, angemessen in „die Kleider der Gerechtigkeit“ gehüllt, schildern ihre fröhliche Ankunft auf dem Fest (Nr. 5) in langen Vokalmelismen und Läufen, hier in eng geführtem Kanon, dort in parallelen Terzen und Sexten, begleitet von munteren Sprüngen in der ausgreifenden Continuolinie.
BWV49 Ich geh und suche mit Verlangen ist eine aus dem Jahr 1726 stammende Dialogkantate, in der die obligate Orgel eine concertoartige Sinfonia vorträgt und die einleitende Arie für Bass sowie das abschließende Liebesduett zwischen der Seele (Sopran) und Christus (Bass), ihrem Bräutigam, einen reich verzierten Abschnitt enthalten. Alles ist darauf ausgerichtet, eine Atmosphäre zu schaffen, in der die Schönheit der Seele geschildert wird. Die Sprache ist sinnlich und erinnert an das Hohelied, ihre religiöse Umhüllung lässt sich schnell durchdringen. Der erste Abschnitt des Duetts, „Komm, Schönste, komm“, ist, wie Whittaker sagt, „ein freimütiges Liebesduett, das sehr gut auf einer italienischen Opernbühne seinen Platz haben könnte“—eine treffende Bemerkung, da wir es in Italien aufführen würden. Der beste Satz ist der vierte, eine Arie für Sopran mit Oboe d’amore und Violoncello piccolo, „Ich bin herrlich, ich bin schön“—eine Art frühe Version von Bernsteins Song „I feel pretty“. Die religiös-erotische Stimmung setzt sich in dem langen Abschlussduett fort, das einen reich verzierten Orgelpart aufweist. Der Sopran singt die siebte Strophe von Philipp Nicolais Choral „Wie schön leuchtet der Morgenstern“ und endet mit den Worten: „Deiner wart ich mit Verlangen“, worauf der Bass aufmunternd antwortet: „Dich hab ich je und je geliebet, und darum zieh ich dich zu mir. Ich komme bald, ich stehe vor der Tür: Mach auf, mein Aufenthalt!“ Keine dieser Doppeldeutigkeiten berührt unangenehm, nur die Länge der einzelnen Sätze, die ein wenig über das erträgliche Maß hinausgehen.
Das gilt nicht für die Choralkantate BWV180 Schmücke dich, o liebe Seele, obwohl ihr Kopfsatz recht lang ist—einer jener im 12/8-Takt gleich einer Prozession gemessen voranschreitenden Sätze, in denen Bach so großartig ist. Hier kombiniert er verhaltene Abschnitte der Bläser (zwei Blockflöten, zwei Oboen, eine davon da caccia) mit einem Thema für die unisono geführten hohen Streicher, dann teilt er die Bläser in Paare auf, zwischen denen über einer fragmentarischen (immer noch unisono gespielten) Streicherfigur ein kreuzrhythmischer Austausch stattfindet. Die Choralfantasie, die mit einer heiteren Cantus-firmus-Melodie in den Sopranstimmen über den verzierten Gesangslinien der drei tiefen Stimmen beginnt, ist geradezu maßgeschneidert für die Seele, die sich für ihre Hochzeit herausputzt. Das Stück schildert anfangs eine Atmosphäre der Zärtlichkeit und Erwartung: das Ankleiden und den Gang zum Hochzeitsfest. Plötzlich (bei Takt 71) steigert sich die Spannung: die Braut ist angekommen (in den getragenen Streicherakkorden wird sogar ihre lange Schleppe angedeutet)—ein Verweis auf die sich in ähnlicher Weise steigernde Spannung in Wachet auf (BWV140, Nr. 1). Die folgende Arie für Tenor und obligate Flöte (Nr. 2), mit deutlichen Anklängen an die Badinerie aus der Orchestersuite in h-Moll (BWV1067), nur in langsamerem Tempo, lässt an eine Mittelfest-Darbietung oder einen Tanz für Einhandflöte und Trommel denken. Doch statt tanzender Mädchen kommt als Antwort auf Jesu Klopfen (in den wiederholten Achteln im Continuo zu hören) die Aufforderung: „Ach, öffne bald die Herzens pforte“. Diese Arie ist frisch, unbeschwert und mitreißend. Vor allem in dem Konzert in Rom inspirierte sie unsere beiden Klavieristen zu einer Darbietung spontanen Überschwangs—mit Boogierhythmen, flippigen Gegenthemen, Skalen, synkopierten Akkorden—, für mich der Stimmung des Stückes und den Gegebenheiten durchaus angemessen, aber für die ortsansässigen Stilwächter Anlass zu grimmigem Stirnrunzeln.
Die auf das Hochzeitsfest bezogene Symbolik ist auch im dritten Satz vorhanden, wo der Sopran mit einer verzierten Version der Choralmelodie, abgesetzt gegen ein sanft arpeggiertes Moto perpetuo für Cello piccolo, die Worte ausdeutet: „Ach, wie hungert mein Gemüte! Ach, wie pfleg ich mich nach dieser Kost zu sehnen! Ach, wie pfleget mich zu dürsten nach dem Trank des Lebensfürsten!“ Die zweite Arie für Sopran (Nr. 5) ist als Polonaise angelegt, unterteilt in Einheiten zu vier und sechs Takten, in denen eine der beiden Oboen und beide Blockflöten gemeinsam mit den ersten Violinen die strahlende Melodie vortragen. Was sich Bach dabei dachte, diese zauberhafte, in sich abgerundete Musik durch die Sopranstimme zu ergänzen, ist rätselhaft. Sie singt nur immer und immer wieder denselben Text (was hätte Johann Mattheson dazu wohl zu sagen gehabt?), über zwanzig Takte lang: „Lebens Sonne, Licht der Sinnen, Herr, der du mein Alles bist!“ Dieses Stück ist eines der wenigen Beispiele für einen Kantatensatz, den Bach offenbar wie im Schlaf komponiert hat, auf jeden Fall hat er sich um den Text wenig geschert.
Der abschließende Choral, ein Musterbeispiel seiner Art, führt alle Fäden der früheren Sätze zusammen—die Thematik des himmlischen Hochzeitsfestes, der Nahrung für die Seele und der Vereinigung mit Gott. Johann Francks eucharistischer Choral ist in Bachs vierstimmiger Harmonisierung unbeschreiblich zärtlich. So sagt Whittaker über diese Kantate: „Sie ist in dieser Reihe diejenige, deren Glückseligkeit ungetrübt bleibt; da gibt es keine Kriege oder Gerüchte von Kriegen, keine beunruhigenden Dämonen oder falschen Propheten, keine Seelenfolter, keine Gedanken an vergangene Sünden, keine Furcht vor dem Jenseits; die Seele gibt sich voller Verzückung ihrem Bräutigam hin, und alles andere ist vergessen.“
Es fügte sich sehr gut, dass wir diese Kantaten mit ihrer weltlichen Symbolik in zwei so farbenprächtigen italienischen Kirchen aufführten: San Lorenzo in Genua ist eine herrliche gotische Kathedrale mit Streifen in polychromem Marmor, der sie aussehen lässt wie ein heiliges Zebra. Die Mischung aus sakralen und profanen Elementen kann kaum deutlicher zutage treten als in der Basilika Santa Maria sopra Minerva in Rom, jener prächtigen gotischen Kirche aus dem 13. Jahrhundert, die der Überlieferung zufolge auf den Fundamenten dreier heidnischer Tempel ruht—für Isis, Serapis und für Minerva, deren Heiligtum Pompeius der Große um 50 v. Chr. errichtete. Sie ist eine wunderbare Schatzkammer mit einer Mischung unterschiedlichster Stile. Mein besonderer Favorit ist die Grabstätte Giovanni Alberinis aus dem 15. Jahrhundert, wo auf einem schönen griechischem Sarkophag aus dem fünften vorchristlichen Jahrhundert dargestellt ist, wie Herkules mit dem nemeischen Löwen kämpft, zwei Renaissance-Engel ihm zur Seite und darüber in voller Länge die liegende Figur des Kardinals. Dieses Grabdenkmal bringt die stilistische Heterogenität dieser zauberhaften Kirche auf den Punkt.
Schätzungsweise viertausend Zuhörer fanden sich zu unserer Aufführung dreier wenig bekannter Bach-Kantaten ein. Sie saßen auf Balustraden, drängten sich in die Seitenkapellen, standen in allen drei Schiffen. Ich kam mir ein bisschen wie ein Gladiator vor, als ich mir einen Weg zum Orchester zu bahnen suchte. Die Temperatur stieg beträchtlich. Die Gegenwart so vieler Menschen, die so lange still ausharrten, so aufmerksam und voller Wertschätzung waren, überwältigte uns alle. Ich fand es erhebend und war mir ständig der einander überlagernden Schichten heidnischer und christlicher Gottesverehrung und der strahlenden Farben bewusst, die Händel so beeindruckt hatten, als er Rom besuchte. Der für Kultur aus dem Vatikan zuständige französische Kardinal saß unmittelbar hinter mir auf seinem herrlichen Thron, von Publikum umgeben. Als ich irgendwann ein paar Schritte zurücktrat, geriet ich versehentlich ein Stück näher an ihn heran, als ich wollte, doch ihn schien das nicht weiter zu stören. Mir war gesagt worden, ich würde schon merken, wenn das Konzert zu Ende sei, weil sich der Kardinal dann erheben und an mich ein paar Worte richten würde. Das tat er denn auch in gemessenem Französisch: „Vous avez évoqué les anges par votre musique: ils sont venus avec leur bénédiction. Merci!“ [„Sie haben mit Ihrer Musik die Engel herbeigerufen. Sie sind gekommen und haben ihren Segen gegeben. Danke!“]. Hinterher fragte mich jemand, warum ich seinen Ring nicht geküsst hätte. Nun ja, was hätte darauf wohl der lutherische Pfarrer in Wittenberg erwidert?
Kantaten für den Einundzwanzigsten Sonntag nach Trinitatis
Old Royal Naval College Chapel, Greenwich
Nach unserer Rückkehr aus Italien und weil der Abstecher nach Osten in die Baltischen Staaten, den wir mit so großer Ungeduld erwartet hatten, nun doch nicht zustande kam, fanden wir uns in London wieder, und wieder einmal in Greenwich, in der Old Royal Naval College Chapel, die ein perfektes architektonisches und akustisches Ambiente bot. Jemand in unserer Gruppe hatte vor kurzem eine deutsche Rundfunksendung gehört, in der ein prominenter Leipziger Bach-Forscher und Theologe behauptete, unsere Pilgerreise mit Bach-Kantaten sei „suspekt“, weil Bach seine Kantaten nie in einem Stück hintereinander und erst recht nicht „in einem Konzert“ aufgeführt habe. Wenn man so verfahre, so sagte er, sei das nicht nur unauthentisch, sondern auch eine Gewähr dafür, dass sich vieles wiederhole, denn es ließe sich doch nicht vermeiden, dass Bach die für einen bestimmten Tag vorgegebenen Texte aus den Evangelien und Episteln auf gleiche Art und Weise verarbeite.
Wer sich vom Gegenteil überzeugen möchte, braucht sich nur die Musik anzuhören, die Bach für diesen Sonntag geschrieben hat. Er schuf nicht weniger als vier überragende Werke, denen der Bericht des Evangeliums zugrunde liegt, wie Jesus den Sohn des königlichen Beamten heilt (Johannes 4, 46-54). Sie unterscheiden sich alle erstaunlich und weisen in ihrer Stimmung und Instrumentierung fein differenzierte Nuancen auf. In der frühesten dieser Vertonungen, BWV109 Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben!, schafft Bach eine Reihe wunderbarer Antithesen, die den inneren Konflikt zwischen Zweifel und Glaube ausdrücken und zeigen sollen, dass der Glaube erst nach einer Zeit des Zweifels gewährt wird. In dem faszinierenden Gewebe des Eingangschors in d-moll, einer Vertonung des Textes aus dem Evangelium („Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben“), unterteilt er die Stimmen zunächst nach Art eines Concerto grosso in Concertisten und Ripienisten, wie er sie in seiner Terminologie nennt (die Quellen nehmen keine verbindliche Aufteilung vor, doch diese ergab sich während der Proben und durch Ausprobieren). Einer Triosonate im Miniaturformat, für eine einzelne Violine und entweder eine oder zwei Oboen mit Continuo, oder zwischen Solostimme, Violine und Oboe, werden weitere Rufe (mit der Anweisung forte) der gesamten Concerto-grosso-Gruppe an die Seite gestellt. Die „Solo“-Stimmen melden sich mit der ersten Aussage zu Wort: „Ich glaube, lieber Herr“ (beginnend mit einer aufsteigenden Quarte, über die sich eine aufsteigende Quinte der zweiten Stimme erhebt), woraufhin die „Tutti“-Stimmen den zweiten Teil beisteuern: isolierte Rufe „hilf“ und dann die sich windende, in die Tiefe zerrende Phrase „hilf meinem Unglauben“. Unendlich faszinierend ist hier, wie diese beiden Aussagen vorgetragen, nebeneinander gesetzt und in einem sich immer weiter verdichten den Austausch zwischen dem Orchester und dem fugierten Teppich, den alle vier Stimmen gemeinsam weben, verarbeitet werden. Bachs Vertonung hebt die Spannung zwischen Glaube und Zweifel auf eine so persönliche Weise hervor, dass man sich fragt, ob sie nicht seinen eigenen Glaubenskampf widerspiegelt.
Zwei sehr eindringliche Sätze schließen sich an: ein Rezitativ und eine Arie für Tenor, in der dieser innere Kampf weiter dramatisiert wird. Im Rezitativ (Nr. 2) verstärkt Bach die Dichotomie zwischen Glaube und Zweifel, indem er ihr zwei, vom selben Sänger gesungene „Stimmen“ zuordnet, die eine mit forte bezeichnet, die andere mit piano, und diese Phrase um Phrase—und in Bachs Rezitativen sicherlich auf einzigartige Weise—miteinander wechseln lässt. (Wie hätte Schumann das geliebt—er, der Schöpfer von Florestan und Eusebius, der es hasste, sich mit einer einzigen einheitlichen Stimme auszudrücken!) Der grundlegende Kampf findet zwischen B-Dur und e-Moll statt, Tonarten, die durch einen Tritonus getrennt sind. Bach heischt um Mit leid, indem er die Phrasen in diese tonal entgegengesetzten Richtungen lenkt: Die (Furcht ausdrückenden) piano-Phrasen ziehen zunächst nach unten, während die lauten Glaubensproteste nach oben und zu Dur streben. In den abschließenden Phrasen verliert die Figur, die auf Eusebius verweist, offenbar die Geduld und lässt einen langen ohrenbetäubenden Schrei hören: „Ach Herr, wie lange?“, den sie in ihrer Verzweiflung zu einem hohen A (mit der Vorgabe forte und im Tempo adagio) treibt, während das Continuo eine Duodezime nach unten taucht, um sich auf einem tiefen E niederzulassen—eine düstere Vorschau auf die sich anschließende Arie. Bislang hat es keine Lösung gegeben. Gott hat nicht geantwortet.
Bach geht nun daran (Nr. 3), das angstvolle Zittern der Seele zu schildern: durch zerrissenen melodische Formen, instabile Harmonien, die zu quälenden Akkorden in der zweiten Umkehrung gelenkt werden, sowie persistierende Figuren in puntiertem Rhythmus. Er plündert die tragischen Ausdrucksreserven der französischen Ouvertüre à la Lully mit verheerender Wirkung, so dass sich anbietet, dieses Stück als frühe Skizze zu Petrus’ Reue-Arie in der Johannes-Passion zu interpretieren. Wie in „Ach, mein Sinn“ ist die Stimmung turbulent, verzweifelt und qualvoll. Alle Energie versackt im „B“-Teil, einer meisterhaften Untermalung der Worte: „Des Glaubens Docht glimmt kaum hervor, es bricht dies fast zustoßne Rohr, die Furcht macht stetig neuen Schmerz“. Die Instrumentierung wird dünner, die Harmonien steuern in entgegengesetzte Richtungen, erst nach d-Moll, dann fis-Moll, weg vom e-Moll der Tonika und, kurz vor dem vollständigen Dacapo, mit einer abrupten Seitwärtswendung von der Dominante (h-Moll) hin zu a-Moll.
An diesem Dreh- und Angelpunkt in der Kantate „versetzt Bach absichtlich, da bin ich sicher“, wie Eric Chafe darlegt, die entsprechenden symbolischen Bedeutungen der Erhöhungs- und Erniedrigungszeichen aus dem Rezitativ (-is aufsteigend, positiv; -es negativ) in die geschlossenen Sätze (-es positiv; -is negativ). So kehrt das folgende Rezitativ für Alt (Nr. 4) mit Worten des Zuspruchs, „weil Jesus itzt noch Wunder tut“, zu d-Moll zurück und liefert das Präludium zu einer sonnigen Arie für Alt und zwei Oboen in F-Dur. Als französischer Passepied angelegt, bringt sie, trotz ihrer Betonung des inneren Konflikts zwischen Fleisch und Geist, die ersten willkommenen Zeichen der Ermutigung. Bach schließt jetzt anstelle der üblichen vierstimmigen Choralharmonisierung mit einer überschwänglichen Fantasie, die ein Gefühl der Erleichterung und des Wohlbefindens vermittelt. Sie beginnt in d-Moll und steuert auf a-Moll zu—eine neutrale Tonart, die „alle vorangegangenen Tonarten zu relativieren scheint, ähnlich wie der Glaube letztendlich den Zweifel überwindet“ (Chafe). Ob man nun eine solche allegorische Interpretation akzeptieren mag oder nicht, eins ist sicher: Bach ist sich bewusst, dass viele seiner Zuhörer hin und wieder in ihrem Glauben schwanken, und er hat dafür Verständnis. Luther betonte, der Glaube werde „zuweilen öffentlich, zuweilen heimlich“ gewährt. Am Ende der Kantate hat man den Eindruck, dass man gehörig in die Mangel genommen wurde.
Dass der Glaube auf „heimliche“ Weise gewährt wird, dieses Thema kehrt in der Kantate des folgenden Jahres (1724) wieder, BWV38 Aus tiefer Not schrei ich zu dir, die auf Luthers berühmtem Choral basiert, in der eine freie Version von Psalm 130 zu der alten phrygischen Melodie gesungen wird. Luther beschrieb diesen Psalm als „heftige und sehr gründliche Worte eines wahrhaftigen reuigen Herzens, das in seinen Jammer auf das allertieffste gekehret ist … Wir sind alle in tiefem grossem Elende; aber wir fühlen nicht alle, wo wir sind. Geschrey ist nicht anders, denn eine sehr starke ernstliche Begierde der Gnade Gottes, welches in dem Menschen nicht erstehet, er sehe denn in welcher Tiefe er liege“. Bach versteht das vollkommen. In einem Eingangschor, der nur 140 Takte lang ist, lässt er Luthers Schrei inständig flehender Stimmen mächtig aus der Tiefe ertönen. Er entschied sich für den strengen stilo antico oder Motettenstil, bei dem die Sopranstimmen jede Zeile der Melodie in langen Noten vortragen und die tieferen Stimmen ihnen imitierend vorangehen. Jede der vier Stimmen verdoppelt er durch eine Posaune—vier Posaunen in einer Bach-Kantate! (Man denkt an Schütz and Bruckner.) Was sie der allgemeinen Stimmung liefern, abgesehen von ihrem einzigartigen polierten Klang, das ist die Würde eines feierlichen Rituals. Bach scheint die Grenzen dieses Motettensatzes durch abrupte chromatische Wendungen hin zu der Melodie in phrygischem Modus absichtlich in einen Bereich außerhalb aller stilistischen Normen zu verschieben.
Im dritten Satz, einer Arie in a-moll für Tenor mit zwei Oboen, übernimmt Bach in seiner Vertonung der Zeilen „Ich höre mitten in den Leiden ein Trostwort“ sein Stichwort wieder aus Luthers Kommentar: Gott sei „so wunderlich in seinen Kindern, dass er sie gleich in widerwärtigen und uneinigen Dingen selig macht; denn Hoffnung und Verzweifeln sind wider einander. Doch müssen sie in dem Verzweifeln hoffen“, denn „in der Furcht, die den alten Adam abbauet, wächst die Hoffnung, die den neuen Menschen formet“. Selten schreibt Bach so durchgängig ineinander verschlungene chromatische Linien für Oboe, in denen es nirgendwo eine Stelle zum Atemholen gibt. Das erfordert eine starke Technik und ein mutiges Spiel.
Die letzten drei Sätze sind alle ungewöhnlich, unnachgiebig und kompromisslos: Zuerst ein Rezitativ für Sopran mit der Anweisung a battuta über einer Basslinie, welche die alte Melodie hervordonnert und zu sagen scheint: „Du wagst es zu zweifeln!“, eine wunderbare Umkehrung der gängigen Praxis und eine Tour de force besonderer Art, denn der Glaube des Soprans erhält kaum Gelegenheit, sich bemerkbar zu machen und seine Schwäche zu offenbaren. Dann ein Terzetto, der Zwillingsbruder der Arie aus der Kantate BWV116, die wir drei Sonntage vorher in Leipzig aufgeführt hatten—„Wenn meine Trübsal als mit Ketten ein Unglück an dem andern hält, so wird mich doch mein Heil erretten, dass alles plötzlich von mir fällt“. Es schildert nun, „wie bald erscheint des Trostes Morgen auf diese Nacht der Not und Sorgen“. Ketten aus Vorhalten setzten einen abwärts gerichteteten Kreislauf aus Quinten durch die Molltonarten in Gang (d, g, c, f, dann B-Dur), während der aufdämmernde Glaube die Richtung nach oben umkehrt, bis die „Nacht der Not und Sorgen“ sie wieder in die andere Richtung lenkt. So unterschiedlich diese drei Sätze sein mögen, sie fließen ineinander und sollten auch so vorgetragen werden. Das abschließende tiefe D der Arie bleibt als Bass des Schlusschorals bestehen, der mit einem über ihm liegenden faszinierenden 6/4-Akkord beginnt, bevor die neue Tonart E-Dur bestätigt wird—„das D, Symbol für Trübsal und Nacht, erhält durch diese Veränderung eine neue Bedeutung“ (Chafe). Wie in BWV109 spart sich Bach das Angebot und die Gewährung von Hilfe bis zur allerletzten möglichen Gelegenheit auf. Mit seinen Stimmen, die alle vom vollen Orchester verdoppelt werden (wieder diese vier Posaunen!), wirkt dieser Choral erschütternd und furchterregend in seiner lutherischen Inbrunst, vor allem die abschließende phrygische Kadenz, wo die Bassposaune bis zum tiefen E abtaucht.
Zeichen und Wunder geschehen in diesem unglaublichen Werk. Schon allein das Wort „Zeichen“ erhält eine aussagekräftige symbolische Bedeutung—durch eine verminderte Septime bei diesem Wort im Sopran-Rezitativ, bei der alle drei „Zeichen“ vorhanden sind: ein Erhöhungszeichen (fis), ein Erniedrigungszeichen (es) und ein Auflösungszeichen (C). Eric Chafe kommt zu dem Schluss: „Da das Johannes-Evangelium auch das Buch der Zeichen genannt wird und Bach die tonale Anlage seiner Johannes-Passion offenbar als eine Art Spiel mit den drei musikalischen Zeichen … konzipiert hat, wohnt diesem wichtigen Detail in der Anlage der Kantate „Aus tiefer Not“ vielleicht eine tiefere Bedeutung inne, die im Zusammenhang steht mit Bachs grundlegender Verfahrensweise im Umgang mit der Tonartensymbolik.“
Nach so viel aufgestauter Kraft erscheint BWV98 Was Gott tut, das ist wohlgetan, im November 1726 entstanden, ausnehmend freundlich. Es ist ein bedeutend kürzeres und intimeres Werk als Bachs andere beiden Kantaten (BWV99 und 100), denen Samuel Rodigasts Choral zugrunde liegt. Obwohl es wie eine Choralkantate beginnt, weist es nicht den typischen konzertierenden Austausch zwischen den Stimmen auf, dem wir mit Bachs zweitem Jahrgang assoziieren. Während der Chor die Zuversicht äußert, dass „sein Wille gerecht bleibt“, und dafür sein Stichwort aus der Epistel bezieht, in der uns Paulus auffordert, „den Harnisch Gottes zu ergreifen“ (Epheser 6, 10-17), befinden sich die ersten Violinen im Zentrum der Aufmerksamkeit. Ihr melodisches Material legt eine der Sprechstimme ähnliche Vortragsart nahe, mit der auf eindrucksvolle Weise das Schwanken der Menschen zwischen Zweifel und der Hoffnung auf Gott zum Ausdruck gebracht wird—eine Technik, die Bach aus vielen Beispielen im Werk seines Cousins Johann Christoph gelernt haben könnte. Whittaker bringt das Wesen der Kantate beispielhaft auf den Punkt: „Der Tenor fleht um Rettung aus seiner Leidensqual (Nr. 2), der Sopran bittet die Augen, sie mögen aufhören zu weinen (Nr. 3), da Gott, der Vater, noch lebt, der Alt flüstert ein Trostwort (Nr. 4), und der Bass erklärt, er werde Jesus nie verlassen (Nr. 5).“ Die anfängliche Überraschung, dass die Kantante nicht mit einem Choral, sondern einer Arie mit einem vergnügten Unisono obbligato für die Violinen in Händel’scher Manier endet, weicht einem Lächeln, sobald klar wird, dass die Worte des Basses in Wahrheit eine leicht verzierte Variante eines Chorals von Christian Keymann (1658) mit dem gleichen Text sind: „Meinen Jesum lass ich nicht“.
Als letztes Werk (und das letzte, das Bach komponierte) stand BWV188 Ich habe meine Zuversicht, von 1728/29, auf unserem Programm. Die einleitende Sinfonia geht auf den dritten Satz des Cembalokonzertes in d-Moll BWV1052 zurück, von dem im Autograph nur die letzten 45 Takte vorhanden sind. Robert Levin hat daher die verlorenen 248 Takte rekonstruiert, und er tat es mit dem ihm eigenen exzellenten Stilgefühl. Das Ergebnis ist eine wahre Freude. Die Eingangsarie gehört zu den gelungensten Arien, die Bach für Tenor geschrieben hat: im „A“-Teil, wo die Betonung auf der Hoffnung liegt, die Zuversicht erst noch erstrebt, nicht schon behauptet wird, pastoral in ihrer Stimmung; im „B“-Teil heftig und dramatisch. Sie ist auch sängerfreundlich, bei Bachs Tenor-Arien eine Seltenheit. Ein langes und vorzügliches Bass-Rezitativ, mit einem Arioso im 6/8-Takt endend, trennt die beiden Arien von der Alt-Arie, vermutlich ein Instrumentalsatz für obligate Orgel, der durch eine Singstimme ergänzt wurde. Dem abschließenden Choral „Auf meinen lieben Gott“ liegt eine Melodie weltlichen Ursprungs zugrunde, die sich auf Venus, die Göttin der Liebe, bezieht. In Bachs Harmonisierung verströmt sie Zuversicht, Vertrauen und Kraft.
Die Old Royal Naval College Chapel bot eine der Stimmung dieser Kantaten förderliche Atmosphäre. Allerdings hatten seit Januar, als wir zuletzt hier waren, die Leute vom Arbeitsschutz ihre Hand im Spiel und unnötige bürokratische und konkrete Hindernisse geschaffen (zum Beispiel „Fluchtwege“, denen wir ausweichen sollten). Unsere Zuhörer waren wirklich ernsthaft interessiert, aber ach so englisch, zu zurückhaltend oder zu ehrerbietig, um irgendeine spontane Regung der Begeisterung zu zeigen—im Gegensatz zu unserem Publikum auf dem Kontinent. Ihr Applaus verhallte gleich wieder wie bei einem Ballon, dem die Luft entweicht.
Sir John Eliot Gardiner © 2010
aus einem Tagebuch während der „Bach Cantata Pilgrimage“
Deutsch: Gudrun Meier
During the year 2000 those remembered tunes and titles came back like long-lost friends, accompanying me as I now sang their intricate and hugely varied elaborations myself, sometimes in the churches that had heard their first performance. What struck me increasingly as the pilgrimage progressed was the deeply calming effect of Bach’s Lutheran certainty that there really is a better life to come: ‘Die Seele ruht in Jesu Hände’, ‘Es ist vollbracht’ and ‘Selig sind die Toten’ held a serenity that many people these days find elusive. So for what ever highly personal reasons, my year of touring with Bach, the Monteverdi Choir and John Eliot was far more than a musical experience. I found and shared new insights, inspiration and even solace.
Today, now that I teach more often than I perform, I cherish one particular choral-scholar baritone in Cambridge, a Korean PhD economist who, though a devout Catholic himself, finds a special fulfilment in singing Bach cantatas. I wonder what he might say, if he looks back on a future Cantata Pilgrimage forty years from now?
Suzanne Flowers © 2010


