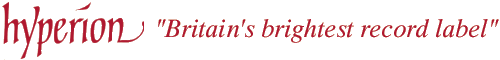
Welcome to Hyperion Records, an independent British classical label devoted to presenting high-quality recordings of music of all styles and from all periods from the twelfth century to the twenty-first.
Hyperion offers both CDs, and downloads in a number of formats. The site is also available in several languages.
Please use the dropdown buttons to set your preferred options, or use the checkbox to accept the defaults.


'Never have I had such a success! I can't get over it. Everyone seems to love the Concert.'
So wrote Chausson in his diary after the first performance of his Concert in D major (1892); the Brussels audience present at this event had won him his first real triumph. The work is a model of cohesion, with strong ideas and melodies of great impact. The autograph manuscript is covered with alterations and crossings-out, signs of the composer's drive towards absolute perfection in this masterpiece of chamber music.
The Piano Quartet was written in 1897 and once again its premiere saw the audience, this time in Paris, moved by the infectious vitality and undeniable force of the music. Had Chausson not died falling off his bike eighteen months later his chamber music output would no doubt have included many more such works and won the recognition which these two works show it to deserve.
This is Chausson’s entry in his diary (as yet unpublished) for 26 February 1892. Each phrase is telling; the reception which the audience in Brussels had given his opus 21 had made him ‘feel light and joyful’ and had given him ‘courage’ to continue with his work. As we all know, a sense of well-being can be very uplifting. Reading this diary, one can sense his enthusiasm and his desire to create. But this real triumph, which his modesty prevented him from broadcasting, was his first. Although he was already thirty-seven, with a sizeable catalogue of works to his name, he was practically unknown. Why?
First, he was not a ‘product of the Conservatoire’. Born in Paris on 20 January 1855 into a well-off family (his father was a public works contractor), he was sworn in as a barrister on 7 May 1877 to please his parents, who wanted him to have a ‘proper job’. But at around the same time he also composed his first mélodie, Les Lilas, and asked for private lessons with Massenet. The latter, recognizing the young man’s obvious flair, soon took him in to his class at the Conservatoire—as Franck was to do shortly afterwards—and encouraged him to enter for the Prix de Rome. It was his lack of success on this occasion (13 May 1881) which brought about a change in him, both psychologically and musically; the result was his wonderful Trio in G minor, Op 3, composed during the summer at Montbovon in Switzerland. During the same period Chausson also composed seven others works which went unnoticed: the Mélodies comprising his opus 2.
Having graduated from law school (like so many of Franck’s pupils!), having failed to follow the usual route of studying at the Conservatoire, and, additionally, having come late to music—after all, he was over twenty years old (which, not surprisingly, imbued his writing with a rare maturity)—Chausson appeared to be out on his own, neither bohemian (like Verlaine) nor conventional like so many others, writing more for his own amusement than for that of the public, and earning himself a reputation for being ‘difficult’ and the ‘Mallarmé of music’!
But there is undoubtedly another much more subtle reason why his compositions were so little-known: although not as well-off as has often been presumed, he was reasonably comfortable and thus shielded from financial insecurity. In fact his diary and letters, whether from friends or business acquaintances, reveal that he was constantly being asked to help out discreetly various impecunious colleagues, or (and one can quite see why!) to become Treasurer of the renowned National Society of Music. Add to these his abhorrence of being taken for an amateur, with his lofty artistic and spirtual aims—‘I understand only that work, constant effort in all things, is always directed towards the same goal’ (letter to Paul Poujaud in the summer of 1888)—and, in an earlier diary, his entry for 20 February 1892: ‘To attain self-belief is a life’s work.’ Given all this, one can understand exactly how triumphant he felt when, for once, a new composition received unanimous praise. The audience had been captivated by the exceptional quality of the writing and the strength of the ideas, the work’s remarkable construction and development, and its instantly memorable tunes.
They were equally impressed by the tautness of the score, possibly due to the fact that it had been written quickly. It is often thought that the four movements of the opus 21 were written in the following order: third movement, May 1889, second movement, October/November 1890, first movement, June 1891 and fourth movement, July 1891. The reality is very different, because the sketches prove conclusively that all the themes were written within the month of May 1889, which explains the work’s perfect cohesion. The crossings out, changes and erasures are merely the hallmarks of the composer’s endless quest for absolute perfection.
The result is superb. From the first bars of the Décidé, the rhythm is established by the first three repeated chords. At bar 35 the first motif is introduced on the violin over a piano appoggiatura: this is the motif which links each movement. After a section of tortured self-doubt, the second theme enters in B flat minor. The development unfolds in the classical style, giving prominence to the first theme, with the emphasis in the repeat being very much on the second. After this bitter confession the Sicilienne appears rather like a rainbow embracing a stormy sky: the colours are unreal, curving elegantly in their crystalline iridescence, dispelling the most vivid anxieties. The following Grave remains one of the most beautiful slow movements ever written, sombre, tragic, developing in a stark, chromatic line. However, the last movement leaves us in no doubt: a triumph of head over heart, swept in by a very animated 6/8 theme pulsating with energy. The second subject, given to the piano, leads back to the clear tonality of D major while simultaneously returning to the principal elements already heard in the preceding pages. The pace broadens and it is in the luminous key of D major that the Concert ends. Chausson has come full circle, with his hopes and doubts, his disenchantments and his most lyrical aspirations intact.
Some years later, in the period between July and September 1897, Chausson was to return to chamber music to compose his Piano Quartet in A major, Op 30, dedicated to Auguste Pierret, who had courageously assured the success of the earlier Concert by standing in, at virtually no notice, for the pianist Litta.
The opening Animé in 2/2 develops into three themes: the first, given to the piano, establishes the key of A major; the second sings on the viola above keyboard sextuplets; and finally the third, plus lent, spreads its lilting rhythm over the right hand of the piano, preceded by a brief reminder of all that has gone before. The development then appears as a kind of perpetual modulation essentially based on the first theme, remaining harmonically in A major throughout, thus allowing numerous rhythmical and tonal combinations, notably C, F sharp, B and E flat. The other two themes are interwoven to add drama and heighten the contrasts and appear in the passages where psychological or musical tensions have crept in. Finally, at the end of the movement, the second subject undergoes several metamorphoses before modulating to A with the recapitulation of the first theme.
The following Très calme, also in ternary form, gives the viola, over long, gentle chords on the piano, a beautiful theme in D flat major. This is followed by a different theme in F, which sheds light on the debate. A radiant calm emanates from this gloriously poetic tune and makes this movement one of Chausson’s greatest achievements.
The Simple et sans hâte, which takes the place of a scherzo, prolongs this mood, the second motif seemingly emerging from the first, with a true elegance accentuated now and again by pizzicati or skilful modulations which give it light and shade.
At first disturbed, the final Animé becomes alert and lively. After a brief introduction, all the themes come into play: the piano provides strong rhythmic accompaniment and, after a brief reminder of the opening subject, a second theme appears, alternating between D flat and C minor. Throughout the development Chausson, true to the cyclical form so beloved of his teacher César Franck, reintroduces the work’s main themes, notably the first and third which dominate, while the tenderness of the fourth softens the impact for a few moments. The finale, however, is unambiguous, leaving the final word to the first subject which resolves in a dazzling A major. The Quartet has an infectious vitality and undeniable force which was fully appreciated when the work was premiered on 2 April 1898 at the National Society of Music by Pierret, Parent, Denoyer and Baretti.
Chausson would no doubt have persevered for a long time had he been judged on his later works, but he had barely eighteen months to live. On 10 June 1899 the life of this great and noble artist was cut short by a fatal cycling accident.
Jean Gallois © 1997
English: Celia Ballantyne
Voilà ce qu’écrit Chausson dans son Journal intime (encore inédit) à la date du 26 février 1892. Chaque mot porte son poids de vérité: l’accueil que le public bruxellois a réservé à son opus 21 lui a «fait du bien» et lui «donne courage» pour continuer son œuvre. On le sait, la joie est dynamogénique. À le lire, on devine bien son enthousiasme, son envie de créer. Car ce réel triomphe—un mot que sa modestie lui interdit d’écrire—est le premier! Or il a trente sept ans et un catalogue déjà important, jalonné d’authentiques chefs d’œuvre passés jusqu’ici pratiquement inaperçus. Pourquoi? pour plusieurs raisons sans doute.
D’abord parce que Chausson n’est pas un «produit de conservatoire». Né à Paris, le 20 janvier 1855, dans un milieu aisé—son père était entrepreneur de travaux publics—il a, pour complaire à ses parents «fait son droit», jusqu’à prononcer le serment d’avocat (7 mai 1877). Mais, à la même époque, il compose sa première mélodie, Les Lilas, et demande des leçons particulières à Massenet. Ce dernier, devinant les éclatantes dispositions du jeune homme, le recevra bientôt dans sa classe du Conservatoire—tout comme Franck peu après—et le poussera à présenter le fameux «Prix de Rome». C’est l’échec (13 mai 1881) qui nous vaudra une éclatante revanche (psychologique et musicale): l’admirable Trio en sol mineur, Op 3, composé au cours de l’été en Suisse, à Montbovon. Mais à cette époque également, Chausson est aussi l’auteur de sept autres chefs d’œuvre passés de la même façon inaperçus: les sept Mélodies composant son opus 2.
En étant d’abord passé par la Faculté de droit—comme maints élèves de Franck!—, en ayant omis de suivre le cursus musical ordinaire passant obligatoirement par le Conservatoire et ses diplômes; en étant enfin venu tard à la musique—à plus de vingt ans!—ce qui d’ailleurs confère d’emblée à son art une maturité; une densité peu communes—Chausson apparaît finalement à beaucoup comme un artiste «à part», ni bohème (comme Verlaine), ni installé dans le monde (comme tant d’autres …), écrivant davantage pour lui-même que pour le public: ce qui le fera taxer «d’auteur difficile», de «Mallarmé de la musique» (sic!) …
Mais il est sans doute une autre raison, plus subtile, et qui l’empêchera toujours de mettre ses compositions en avant: une certaine aisance financière, réelle quoique souvent surestimée et qui lui dicte de contraignantes responsabilités. Son Journal, sa correspondance en témoignent qui lui interdisent de solliciter amis ou impresarios, le poussant au contraire à aider discrètement certains confrères impécunieux ou à devenir—et l’on voit bien pourquoi!—trésorier de la S.N.M.,—la fameuse Société Nationale de Musique. Ajoutons à ces contraintes morales et à la crainte horrifiée de passer pour un amateur, sa haute exigence artistique et spirituelle: «Je ne comprends que l’effort, l’effort constant en toutes choses, et toujours dirigé vers le même but» (Lettre à Paul Poujaud, été 1888). Profession de foi que prolonge le Journal de 1892: «Se créer soi-même, c’est là tout l’effort de la vie» (20 février).
Dans ces conditions, l’on comprend ce que pouvait représenter la création triomphale du Concert pour une fois salué unanimement. Les auditeurs ont été frappés par la qualité exceptionnelle de l’ouvrage et la fermeté des idées, remarquablement dessinées, facilement mémorisables et se prêtant à d’ingénieuses métamorphoses. Frappés également par la rigueur du propos—point de redites, aucun «remplissage»—due sans doute au fait que la partition a été écrite rapidement, avec une vision globale de l’ensemble ce que traduisent la concision, la cohésion de la forme, la puissance dialectique des thèmes: le Concert est une force qui va, sûre d’elle-même et emportée par son dynamisme intérieur.
Une tradition veut que les quatre mouvements de l’opus 21 aient été écrits dans l’ordre III (mai 1889), II (octobre–novembre 1890), I (juin 1891) et IV (juillet 1891). C’est s’en tenir à l’état définitif de chaque volet, car la réalité est toute autre et les brouillons du musicien démontrent sans ambiguïté que tous les thèmes du Concert ont été dessinés dès le mois de mai 1889: ce qui, justement, donne à l’œuvre sa parfaite cohésion. Ratures, repentirs, gommages ultérieurs ne sont donc que la matérialisation apparente d’une pensée sans cesse en quête de perfection, sinon d’absolu.
L’œuvre est superbe. Dès l’introduction du Décidé liminaire, s’impose par deux fois une cellule rythmique formée par les trois premiers accords. À la 35e mesure apparaît le premier motif proprement dit (A) contenant les trois notes cycliques, et clairement exposé, sur un dessin appogiaturé du piano, par le violon solo: c’est ce motif qui servira de lien entre chaque mouvement. Après un pont où percent de sourdes interrogations, survient le second motif (B) en si bémol mineur. Le développement se déroule de façon classique, donnant la prééminence au thème (A), la réexposition se faisant, elle, essentiellement sur (B). Après cette âpre confession la Sicilienne apparaît un peu comme l’écharpe d’Iris, pur arc-en-ciel cintrant un ciel d’orage: elle en a les couleurs irréelles, l’élégante courbe, la cristalline immanence. Comme un pont que traverse une bouffée d’air frais, elle relie deux berges où sourdent les plus cruelles inquiétudes.
Car le Grave suivant reste l’un des plus beaux thrènes qui soient, sombrement, sobrement tragique, développant une longue ligne chromatique dépouillée. Pourtant, le dernier mouvement ne laisse aucun doute, qui vient opposer son éloquence limpide, telle une revanche de la raison sur le sentiment, emporté par un thème Très animé à 6/8, ivre de liberté et d’énergie. Quant à la seconde idée, également confiée au piano, elle ramène, avec son rythme de longues et brèves, la claire tonalité de ré majeur, autour de laquelle va désormais, s’articuler le mouvement, avec le retour des principaux éléments entendus dans les pages précédentes: (A) ou (B), seconde idée du Grave. Le tempo s’amplifie et c’est dans un lumineux ré majeur—tonalité des triomphes heureux—que s’achève ce Concert où Chausson apparaît tout entier, avec ses espoirs et ses doutes, ses désenchantements passagers et ses aspirations les plus lyriques à la Lumière.
Un lustre plus tard, de juillet à septembre 1897, Chausson revient à la musique de chambre et compose son Quatuor avec piano, Op 30, en la majeur, dédie «À Auguste Pierret» qui avait courageusement assuré le succès du précédent Concert en remplaçant, presque au pied levé, le pianiste Litta, défaillant. Sans être vraiment une œuvre «heureuse», l’opus 30 retrouve un sourire, une clarté qui prennent ici un relief accusé et inattendu.
L’Animé initial à 2/2 s’appuie sur trois thèmes: (A) confié au piano, impose la tonalité de la majeur; le second (B) chante à l’alto sur les sextolets du clavier; le troisième enfin (C), marqué «plus lent», déploie son rythme berceur à la main droite du piano, précédé d’un bref pont modal. Le développement apparaît alors comme une sorte de modulation perpétuelle, essentiellement basée sur (A), reposant tout entier sur la gamme de la majeur sans altérations étrangères, permettant ainsi, par son aspect «monolithique» de nombreuses combinaisons rythmiques ou tonales (ut, fa dièse, si, mi bémol notamment). Si les deux autres idées (B) et (C) interviennent aussi, c’est essentiellement pour dramatiser la pensée et accuser les contrastes: lorsqu’elles apparaissent, en effet, c’est dans les passages où naît une certaine tension psychologique ou musicale. Ainsi, à la fin du mouvement, (B) modifié semble hésiter à choisir une tonalité précise avant que s’impose celle de la, grâce à la résurgence du thème (A).
Le Très calme suivant, également de forme ternaire, confie à l’alto, sur de longs accords calmes du piano, le chant d’un beau thème (D), en ré bémol majeur. Puis vient un nouveau motif (E) en fa majeur, qui éclaire le débat. De ce long lied un peu grave où s’exprime toute la poésie de Chausson, émane une douceur irradiante qui fait de ce mouvement une des plus belles réussites du compositeur.
Le Simple et sans hâte suivant—qui prend alors la place d’un scherzo—poursuit heureusement cette atmosphère, clair dans son rythme et ses composantes (le second motif G semble «secreté» par le premier F), avec une réelle élégance que soulignent çà et là les pizzicati des archets ou d’habiles modulations qui l’habillent de cent couleurs.
D’abord inquiet, indécis, le final Animé expose d’entrée un motif alerte et vif. Après cette brève introduction modale, se détachent les véritables éléments constitutifs: (H) fortement rythmé, confié au piano; puis, après un furtif écho de (A), un second motif réapparaissant en valeurs longues, soit en ré bémol, soit en ut mineur. Au cours des développements, Chausson, fidèle à la «forme cyclique» chère à son maître César Franck, réintroduit les principaux thèmes de sa partition. Retour heureux, qui précise la pensée du musicien puisque ce sont les motifs les plus virils (A et C) qui l’emportent, même si la tendresse de (D) infléchit le discours pendant de brefs instants. La conclusion cependant demeure sans ambiguïté, qui laisse la parole au thème initial, faisant éclater en pleine lumière, en pleine force aussi, son éclatant la majeur, conférant ainsi à ce quatuor une vitalité, un enthousiasme, une force indéniables. C’est bien ce que comprit le public lorsque l’œuvre fut créée, le 2 avril 1898 à la S.N.M. par Pierret, Parent, Denoyer et Baretti. Elle produisit un effet immédiat et partout l’on prit plaisir à souligner «la belle envolée lyrique, les harmonies toujours distinguées, l’élégance du rythme», de la nouvelle partition, et l’on s’accorda à y voir «une indication voulue de limpidité». Cette démarche, Chausson l’eût sans doute poursuivie longtemps si l’on en juge par ses derniers ouvrages. Hélas, à cette époque, il ne lui restait qu’à peine dix huit mois d’existence. Jusqu’au fatal accident de bicyclette qui, le 10 juin 1899, mit un point final à sa création. Celle d’un grand et noble artiste.
Jean Gallois © 1997
Diesen auf den 26. Februar 1892 datierten Eintrag findet man in Chaussons (noch nicht veröffentlichtem) Journal. Jedes einzelne Wort trifft die Wahrheit: Die Art und Weise, in der das Brüsseler Publikum auf sein Opus 21 reagierte, hat ihm „gut getan“ und ihn „ermutigt“, an seinem Werk weiterzuarbeiten. Man weiß es ja: Freude wirkt dynamisierend. Wenn man seine Zeilen durchliest, entdeckt man deutlich seine Begeisterung und seinen Arbeitseifer. Denn dieser wahrhaft große Triumph seines Werkes—welches zu schreiben ihm seine Bescheidenheit eigentlich verboten hätte—war tatsächlich der erste! Zu diesem Zeitpunkt war er 37 Jahre alt und konnte schon auf einen beachtlichen, zahlreiche Meisterwerke enthaltenden Katalog von Werken zurückblicken, die bis heute aber praktisch unbeachtet geblieben sind. Warum? Dafür gibt es sicherlich mehrere Gründe.
Zunächst einmal deshalb, weil Chausson kein „Produkt des Konservatoriums“ ist. Am 20. Januar 1855 in Paris geboren, in gutsituierten Verhältnissen aufgewachsen—sein Vater war als Unternehmer im öffentlichen Dienst tätig—, verfolgte er „seine juristischen Studien“ den Eltern zuliebe bis hin zu seiner Vereidigung als Rechtsanwalt (am 7. Mai 1877). Zum gleichen Zeitpunkt komponiert er aber auch seine erste Mélodie namens Les Lilas und bemüht sich bei Massenet um Einzelunterricht. Dieser erkannte die herausragende Begabung des jungen Mannes, nahm ihn bald darauf in seine Klasse am Konservatorium auf—genauso wie Franck kurze Zeit später—und hielt ihn dazu an, zum berühmten „Prix de Rome“ anzutreten. Eben jener Mißerfolg (vom 13. Mai 1881) sorgte dafür, daß uns heute eine Revanche (psychologischer und musikalischer Art) vorliegt: das meisterhafte Trio in g-Moll, Opus 3, das er während seines Sommeraufenthaltes in Monthoven (Schweiz) komponiert hat. Zur gleichen Zeit hat er aber auch noch sieben andere Meisterwerke geschrieben, die ebenfalls unbeachtet geblieben sind: die sieben Mélodies, aus denen sich sein Opus 2 zusammensetzt.
Dadurch, daß Chausson jemand war, der zunächst also die juristische Fakultät hinter sich gebracht hatte—wie übrigens manch anderer Schüler von Franck!—, jemand, der es unterlassen hatte, die gängigen Stationen musikalischer Ausbildung zu durchlaufen, die obligatorischerweise über das Konservatorium und seine Diplome erreicht wurden, als jemand, der spät an die Musik geraten war (mehr als 20 Jahre später!), was seiner Musik übrigens sofort eine gewisse Reife und ungewöhnliche Dichte verleiht, gilt er letztendlich oft als ein Künstler „im Abseits“: Er war weder Bohème (wie Verlaine) noch war er jemand, der sich in der Gesellschaft etabliert hatte (wie so viele andere …). Chausson schrieb in erster Linie für sich selbst, nicht für die Öffentlichkeit. Dies führt dazu, daß er als Komponist „schwer einstufbar“, daß er sozusagen ein „Mallarmé der Musik“ (sic!) ist …
Sicherlich gibt es aber auch noch einen anderen, subtiler gelagerten Grund, der ihn stets daran gehindert haben muß, seine Kompositionen öffentlich vorzulegen: Chausson befand sich in einer entspannten finanziellen Situation, und obwohl sein Reichtum im allgemeinen überschätzt wird, hat dieser Tatbestand mit Sicherheit eine Rolle gespielt und ihm gewisse einschränkende Verantwortlichkeiten auferlegt. Sein Journal und seine Briefe bezeugen, daß es ihm nicht erlaubt war, sich an Freunde oder Impresarien zu wenden, daß er sich gerade im Gegenteil dazu veranlaßt fühlte, bestimmten mittellosen Kollegen heimlich unter die Arme zu greifen oder Schatzmeister der S.N.M., der berühmten Société Nationale de Musique—und es ist auch genau ersichtlch, warum!—zu werden.
Zu seiner moralischen Zwangslage und seiner Furcht, als Amateur bezeichnet zu werden sei noch hinzugefügt, daß er hohe künstlerische und spirituelle Anforderungen an sich selbst stellte: „Ich verstehe darunter Anstrengung, konstante Anstrengung in allen Dingen, die stets auf dasselbe Ziel ausgerichtet ist“ (Brief an Paul Poujaud im Sommer 1888). Es ist dies ein Bekenntnis, das sich auch weiterhin in seinem Journal von 1892 findet: „Sich selber schaffen, darin besteht die gesamte Anstrengung des Lebens“ (20. Februar).
Unter diesen Umständen wird verständlich, was die triumphale Aufführung des Konzertes, nachdem es einhellig begrüßt worden war, bedeutet haben mag. Die Zuhörer waren von der außergewöhnlichen Qualität des Werkes und der mit Bestimmheit vorgetragenen Ideen, die auf bemerkenswerte Weise nachvollziehbar und einprägsam sind, sich genialen Metamorphosen zudem förmlich anbieten, schlichtweg frappiert. Ebenso waren sie über die Strenge der Themen erstaunt: keine Wiederholungen, keinerlei „Füllmaterial“, was mit Sicherheit darauf zurüchzuführen ist, daß die Partitur ziemlich schnell und mit Blick auf ein umfassendes Ganzes geschrieben wurde. Präzision, Kohäsion der Form und dialektische Ausdruckskraft der Themen deuten darauf hin: Das Konzert verfügt über einen Kraftimpuls und wird, selbstsicher wie es zu sein scheint, von seiner inneren Dynamik vorangetrieben.
Traditionellerweise wird davon ausgegangen, daß die vier Sätze von Opus 21 in der Reihenfolge III (Mai 1889), II (Oktober/November 1890), I (Juni 1891) und IV (Juli 1891) geschrieben wurden. Dies würde bedeuten, daß man sich an den definitiven Zustand jedes einzelnen Stückes halten müßte. Die Wirklichkeit ist allerdings eine andere, und die Konzepte des Musikers zeigen eindeutig, daß alle Themen des Konzertes zur gleichen Zeit, im Mai 1889, aufgezeichnet wurden: Genau diesem Umstand verdankt das Werk seinen perfekten inneren Zusammenhang. Streichungen, Bedauern, und letztendlich ausradierte Stellen sind demnach die materielle Umsetzung einer unablässigen gedanklichen Suche nach Perfektion, wenn nicht sogar nach dem Absoluten.
Das Werk ist großartig. Gleich nach dem Einleitungsteil des zu Beginn stehenden Décidé prägt sich durch die ersten drei Akkorde an zwei Stellen eine geschlossene rhythmische Einheit ein. In Takt 35 erscheint das erste richtige Motiv (A), das die drei zyklischen Noten enthält und das sich, von der Solo—Violine gespielt, deutlich gegenüber einer Vorschlags—Linie des Klaviers abhebt: genau dieses Motiv sorgt im folgenden für die Verbindung zwischen den einzelnen Sätzen. Nach einem Überbrückungsteil, in dem dumpfe Fragen stechend durchdringen, taucht das zweite Motiv (B) in b-Moll auf. Die Durchführung erfolgt in klassischer Manier, Thema (A) steht im Vordergrund, die Wiederkehr baut ihrerseits hauptsächlich auf Thema (B) auf. Nach diesem rauhen Bekenntnis wirkt die Sicilienne ein bißchen wie die Schärpe der Iris, wie ein naturreiner Regenbogen, der sich am gewitterumwölkten Himmel wölbt: sie hat etwas von jenen irrealen Farben, der eleganten Bogenform, dem kristallin Immanenten. Wie eine Brücke, die durch eine frische Brise hindurchführt, verbindet sie zwei Ufer, an denen sich die furchtbarsten Ängste regen.
Das darauffolgende Grave ist und bleibt eines der schönsten Threnodien: düster, auf nüchterne Weise tragisch, entwickelt es eine lange chromatische, schmucklose Linie. Der letzte Satz hingegen läßt gar keine Zweifel aufkommen, widersetzt sich mit klarer Beredtsamkeit und gleicht einem Sieg der Vernunft über das Gefühl. Er wird von einem mit Très animé überschriebenen Thema im 6/8-Takt getragen, ist trunken von Freiheitsdrang und voller Energie. Die zweite, ebenfalls dem Klavier anvertraute Idee führt mit ihren aus kurzen und langen Noten bestehenden Rhythmus in die klare Tonart von D-Dur zurück, in der sich ab dieser Stelle der Satz ausdrücken wird, wobei die auf den vorangehenden Seiten gehörten Elemente erneut auftauchen: (A) und (B) bildet die zweite Idee im Grave. Das Tempo verschnellert sich. Chausson beendet sein Konzert in der strahlend wirkenden Tonart D-Dur—einer Tonart glücklicher Triumphe. Hier entfalltet sich Chausson ganz, mit all seinen Hoffnungen und Zweifeln, seinen vorübergehenden Desillusionen und seinen höchst lyrischen Sehnsüchten nach dem Licht.
Ein Lustrum später, von Juli bis September 1897, kehrt Chausson zur Kammermusik zurück und komponiert sein Klavierquartett in A-Dur (Opus 30), ein Stück mit der Widmung „À Auguste Pierret“. Dieser hatte mutig für den Erfolg des vorangehenden Konzertes gesorgt, indem er fast aus dem Stegreif anstelle des verhinderten Pianisten Litta spielte. Ohne Opus 30 ein wirklich „glückliches“ Werk nennen zu wollen, kann man sagen, daß dieses Werk in eine fröhliche Stimmung und überdies in eine Klarheit zurückkehrt, die an dieser Stelle ausgesprochen deutliche, unerwartete Konturen bekommt.
Das zu Beginn stehende Animé im 2/2-Takt stützt sich auf drei Themen: Thema (A), das dem Klavier anvertraut ist, legt die Tonart A-Dur fest. Das zweite Thema (B) wird in hoher Stimmlage über den Sextolen des Klaviers gespielt. Das dritte, mit der Tempoangabe „langsamer“ versehene Thema (C) schließlich entfaltet seinen wiegenden Rhythmus in der rechten Hand des Klaviers, wobei eine kurze modale Überleitung vorangeht. Die Durchführung erscheint im folgenden als eine Art ständige Modulation, stützt sich im wesentlichen auf Thema (A), greift auf die gesamte Tonleiter in A-Dur zurück, ist frei von fremden Alterationen und erlaubt durch seinen monolithischen Aufbau zahlreiche rhythmische oder tonale Kombinationen (insbesondere c, fis, h und es). Wenn sich zuweilen auch die beiden anderen Themen (B) und (C) zu Wort melden, dann geschieht dies deshalb, um die Gedanken dramatisieren und die Kontraste deutlicher formulieren zu können: sie tauchen in der Tat an den Stellen auf, an denen eine gewisse psychologische oder musikalische Spannung entsteht. Auf diese Weise scheint sich das modifizierte Thema (B) am Ende des Satzes nur zögerlich auf eine bestimmte Tonart festlegen zu wollen. Erst danach setzt sich A-Dur durch das wiederauftauchende Thema (A) durch.
Das folgende Très calme, das ebenfalls eine aus mehreren Teilen bestehende Form aufweist, vertraut der Bratsche das sehr schöne Thema (D) an, das über langen, ruhigen Akkorden des Klaviers gespielt wird und in der Tonart Des-Dur notiert ist. Mit dem Thema (E) in F-Dur tritt ein neues, die Debatte anheizendes Motiv ein. Dieses lange Lied, das ein bißchen düster erscheint und in dem die ganze Poesie Chaussons zum Ausdruck kommt, verbreitet eine strahlende Sanftheit und gestaltet den Satz zu einem der schönsten Erfolge des Komponisten.
Das darauf folgende Simple et sans hâte—das im übrigen anstelle eines Scherzos steht—ist in bezug auf seinen Rhythmus und seine Komponenten klar strukturiert (wobei das zweite Motiv G durch das erste Motiv F scheinbar „verheimlicht“ wird) und verfolgt die Atmosphäre des vorangehenden Satzes auf geglückte Weise und mit wahrhafter Eleganz, die hier und da von den Pizzicati der Streicher oder von geschickten Modulationen hervorgehoben wird und dem Stück hundert Farben verleihen.
Zunächst einmal unruhigen, unentschlossenen Charakters, enthüllt das finale Animé gleich zu Beginn ein aufgewecktes, munteres Motiv. Nach dieser kurzen modalen Einleitung treten die eigentlichen konstitutiven Elemente zu Tage: Thema (H) ist stark rhythmisch und dem Klavier anvertraut.
Darauf erscheint, nach einem flüchtigen Echo von Thema (A), wiederholt ein zweites Motiv in langen Notenwerten, das entweder in des oder in c-moll notiert ist. Im Verlauf der Durchführung der Themen führt Chausson, getreu der seinem Meister César Franck geschätzten „zyklischen Form“, die Hauptthemen seiner Partitur erneut ein. Es ist dies eine glückliche, die Gedankenführung des Musikers präzisierende Wiederaufnahme, weil es sich bei (A) und (C) um die zwei kraftvollsten, Chausson mitreißende Themen handelt, selbst wenn der sanfte Charakter von Thema (D) den Diskurs während kurzer Momente beugt. Die Schlußgruppe hingegen weist keine Mehrstimmigkeiten auf, das Anfangsthema übernimmt das Wort, hier entfaltet sich in vollem Licht und bei voller Stimme die strahlend wirkende Tonart D-Dur und verleiht dem Quartett auf diese Weise Vitalität, Enthusiasmus und unbestreitbare Ausdruckskraft. Genau in diesem Sinne hat das Publikum das Werk auch aufgefaßt, als es am 2. April 1898 an der S.N.M. von Pierret, Parent, Denoyer und Baretti aufgeführt wurde. Die Wirkung des Stückes trat augenblicklich ein, und im Hinausgehen wies man mit Freude auf die „schönen lyrischen Höhenflüge, die stets distinguiert herausgearbeiteten Harmonien und die rhythmische Eleganz“ der neuen Partitur hin und man einigte sich darauf, darin einen „gewollten Hinweis auf Klarheit“ zu sehen.
Wenn man die letzten Werken Chaussons betrachtet, kann man davon ausgehen, daß er sicherlich auch weiterhin Schritte in diese Richtung unternommen hätte. Unglücklicherweise blieben ihm von diesem Zeitpunkt an aber kaum mehr als 10 Monate bis zu seinem tödlichen Fahrradunfall, der dem Werk eines solch großartigen und feinen Künstlers am 10. Juni 1899 einen Schlußpunkt setzte.
Jean Gallois © 1997
Deutsch: Inge Schneider

