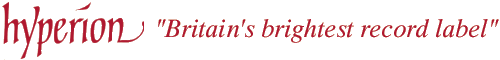
Welcome to Hyperion Records, an independent British classical label devoted to presenting high-quality recordings of music of all styles and from all periods from the twelfth century to the twenty-first.
Hyperion offers both CDs, and downloads in a number of formats. The site is also available in several languages.
Please use the dropdown buttons to set your preferred options, or use the checkbox to accept the defaults.

Playful yet serious, imaginative yet true to the spirit of the originals: Alban Gerhardt and the inimitable Alliage Quintett offer a wholly new perspective on a variety of favourites drawn from the cello’s established repertoire and beyond.


In his A major Variations on a Rococo theme Tchaikovsky paid homage to one of his idols, Mozart, without resorting to imitation. The ‘Rococo-ness’ of the work resides largely in the metrical regularity and decorous containment of its phrases, and in the reduction of Tchaikovsky’s customary symphonic forces to a Classical line-up consisting of double woodwinds, two horns and strings. In the arrangement by Stefan Malzew presented here, the pianist discreetly absorbs orchestral elements lying at or beyond the top and bottom of the saxophones’ collective range, such as high-flying woodwind filigree or bass lines reinforced at the sub-octave. An element that affords Malzew greater freedom and variety in the parameters of his rescoring is his decision not to regard the original cello solo part as entirely sacrosanct: while the cellist remains generally at the forefront of the texture, in a few salient passages he cedes his melodic material to other players—for example, to the alto saxophone at the start of variation 3, and to the baritone midway through variation 6.
In the Malzew arrangement, Tchaikovsky’s end-of-phrase woodwind interjections during variation 1 are subtly elaborated rhythmically by the saxophone group, while in variation 2 the pianist adds delicate embroidery at corresponding points. The piano is the ideal medium for redeployment of Tchaikovsky’s balletic woodwind repeated chords in the reprise of variation 3. The fourth variation remains almost entirely faithful to the original. In variation 5 Tchaikovsky’s flute melody is evocatively replaced by the soprano saxophone, and the cadenza concluding this section receives one or two harmonic adumbrations, added with the lightest of touches.
Up to this point, there has been every reason to take Malzew’s arrangement entirely seriously, and at times one marvels at the felicity and aptness of his re-imaginings. With the added opening two bars of the minor-key variation 6, however, it becomes clear that enjoyable immersion in the music need not come with a straight face. While the harmonic substructure of the original variation remains almost wholly intact, Tchaikovsky finds himself whisked away in a musical time machine and deposited a century and a half later, apparently in the bowels of some smoke-filled basement nightclub. The music remains soulful, yet along lines undreamt-of by its composer. Malzew forbids us to take things too seriously. At the start of variation 7 the blues abates but the twenty-first century is in less of a hurry to release its grip, launching this finale on decidedly astringent and modern terms. Deft scoring allows all the instrumentalists to play a dynamic and engaging part in the proceedings, fashioning an entirely plausible chamber equivalent to Tchaikovsky’s orchestral virtuosity with his Classical orchestra. However, an egregiously reharmonized penultimate bar reminds us that, above all, fun is to be had by performers and audience alike.
Vivaldi’s Cello Concerto in A minor, numbered RV418 in the definitive Vivaldi catalogue by the Danish musicologist Peter Ryom, requires more extended time-travelling by this recording’s instrumentalists: written during the 1720s, it has existed for roughly twice as long as Tchaikovsky’s Variations in their original form. Despite this, however, it presents a more organic alignment of instrumental scale between Vivaldi’s score and the arrangement by Itai Sobol, with the saxophone quartet naturally inheriting the roles of the Baroque string orchestra. The piano oscillates between an updated harpsichord continuo realization, drawn from Vivaldi’s figured bass, and something that acknowledges the modern instrument’s sustaining pedal, likewise its singing quality (used here to double and reinforce the saxophones in a ‘roving’ capacity). Vivaldi’s concerto-writing by this time was already anticipating the decline of counterpoint as the mainspring of Baroque compositional technique. The A minor concerto’s first movement points forward to a later, more galant style, with its sedate unanimity of harmonic rhythm (often running counter to a surface impression of energetic activity) and its consistent accentuation of first beats in the bar. Sobol exploits the opportunity to divide slow-moving harmonic content between rhythmically active repeated notes from the saxophones and underlying sustained chords from the piano, and then to reverse this polarity to enhance variety of texture.
The brief slow movement is bookended by a homophonic texture in which the piano assumes a melodic foreground role. Between these passages comes a soulful cantilena which preserves the cello soloist’s original material before respecting Baroque practice through the insertion of an unaccompanied cadenza. The hectic third movement mirrors the first by adopting a one-chord-per-bar harmonic pace. Since the actual rate of harmonic change tends to work against fast-moving short notes on the surface of the texture, one is reminded of the anonymous person who is reported to have claimed later, and for the same reason, that ‘all Mendelssohn’s fast music is slow music in disguise’. Certainly Vivaldi’s harmonic handling tempers his fast music’s energy with a sense of decorous containment that points the way towards emergent Classicism. Sobol encourages that perception by imparting melodic importance to the pianist’s right hand in the central stages of this movement, lending the proceedings a distinct if intermittent Mozartian twist.
In April 1913 the Andalusian composer Manuel de Falla’s opera La vida breve earned him his first popular triumph at its performance in the French city of Nice. Returning to his native Spain in 1914 after several years based in Paris, Falla consolidated his success with a cycle of popular Spanish songs. These too gained an immediate popularity which led to their being orchestrated and arranged for various instruments. Transcribed for violin, six of them became the Suite populaire espagnole. This haphazard genesis has perhaps encouraged a sense of carte blanche in the minds of subsequent transcribers; certainly, there is a sense of freedom in the allocating of textural elements to new instruments, of which the arranger Sebastian Gottschick takes full and idiomatic advantage in the Siete canciones populares españolas (‘Seven Spanish popular songs’).
El paño moruno highlights the versatility of the saxophone group, its mimicry of pizzicato (plucked) bass lines giving way later to a re-statement of the main theme in which the rich chordal sonority of the four wind instruments creates a vivid contrast with what has gone before. The movement as a whole is gently ear-tickling thanks to its displacement of accents, keeping the listener guessing how many beats there are in the bar.
Murcia is a province bordering Andalusia. The seguidilla is a breezily energetic triple-time dance for two people, here notable for its brevity and punctuated by abrupt and pronounced slowings-down before the prevailing tempo is resumed.
Asturias is a mountainous principality towards the western end of Spain’s northern coastline, characterized by a temperate, wet climate and abundant green vegetation. In the introduction to Asturiana Gottschick deftly embeds successive notes of the melodic outline within different saxophone parts to create an overlapping tapestry; this anticipates the sense of disconsolate, dream-like remoteness with which the solo cello sings its sustained melody. Later this melody is overlaid by the soprano saxophonist, whose hushed and drooping glissando effects impart a new level of desolation. The piano’s pianissimo semiquaver pattern in the background aptly suggests a continuum of gentle rain.
The jota is a dance of courtship popular in northern Spain, particularly Aragon, and is commonly accompanied by castanets played by the dancing couple. Falla’s Jota starts with a light-footed pattern that may be a principal theme or an accompanying figure set up in anticipation of a melody. Melody duly arrives in the form of a broader, sustained line which quickly becomes languorous before suddenly giving way again to the movement’s opening mood.
Nana is a hushed lullaby. Its hypnotic quality arises first from the piano’s quietly obsessive repetition and secondly from its subsequent interaction with the same overlapping ‘tapestry’ technique already noted in Asturiana. Here the extreme pianissimo of the alternating saxophone tones creates a magically eerie effect not unlike the timbre of a vibraphone.
The fleeting Canción (‘Song’) partially mimics the opening movement by presenting a theme which may be starting on the last note of the bar or on the first—an agreeable ambiguity is sustained. A kind of skittish fragility in the solo cellist’s sonority here arises from ingenious use of harmonics (where lightly touching a string with a second finger enables overtones to emerge). This is then subject to imitative dialogue between first alto and then soprano saxophone.
Polo is a flamenco musical form in which unpredictable accentuation creates the illusion of fluctuation between a faster and a slower musical pulse. Falla’s Polo here forms the briefest of finales, ending abruptly but not before the music’s unbridled wildness has been vividly conveyed by high-flying octaves between the solo cello and soprano saxophone, the latter revealing its propensity for a theatrical edge of hysteria where needed.
Confirming that both whimsical fun and the spirit of jazz permeate these arrangements, Sebastian Gottschick has commented that his work on the Falla score coincided with an adaptation of George Gershwin’s Porgy and Bess, during which he was particularly taken with one song from the opera, ‘Here come de honey man’, in its 1958 re-interpretation by Miles Davis and Gil Evans. Gottschick was inspired to make his own version in tribute to both Davis and Gershwin. It has not been unknown for this to find itself playfully inserted between Falla’s Nana and Canción under the title ‘Intermezzo ad lib.’, though it remains absent from the present recording.
Shostakovich composed his score for the film The gadfly in 1955. The screenplay depicts the life of a swashbuckling hero in early nineteenth-century Italy. The film attracted high viewing figures within the Soviet Union, but its music is better known through the concert suite arranged later by the composer’s friend, Levon Atovmian. The Prelude heard here remains close in content and spirit to Atovmian’s simple separate arrangement of the music for two violins and piano, in a miscellany which also includes an Elegy, from Shostakovich’s incidental music (originally for small orchestra, Op 37, 1933-34) to the play The human comedy, itself adapted from Balzac. In both pieces the piano preserves Atovmian’s transcription, while the cello and a solo baritone saxophone play the violin parts an octave lower than originally written (for one brief moment, two octaves lower), imparting to them a newly autumnal dimension which embraces a distinctly Schubertian, slow Ländler melancholy in the Elegy.
Shostakovich’s eight-movement Suite for variety orchestra was written sometime after 1956 but cannot be precisely dated. Its original line-up includes two alto and two tenor saxophones, as well as other woodwinds, a full brass section, harp, two pianos (one doubling celesta), three percussionists playing a wide variety of tuned and untuned instruments, and strings. Waltz No 2 in C minor may awaken an agreeable frisson of unexpected recognition in the listener, since its ‘haunted ballroom’ ambience has commended it to the attentions of a whole host of music editors for both television and film. In Louis-Noël Fontaine’s arrangement, the piano confines itself to an unwavering ‘oom-pah-pah’ rhythmic and harmonic role throughout, but the melodic thread is passed back and forth between the saxophones, with the cello either doubling these in unison or taking its own solo turn. The more overtly nostalgic major-key secondary episode gives rise to a lively background of running triplets, their increasingly chromatic contours slithering between notes of the melody. If Shostakovich had a ballroom genuinely in mind, one feels, it could plausibly be that of RMS Titanic.
George Gershwin’s Rhapsody in blue was commissioned in 1924 by the New York bandleader Paul Whiteman. Owing to both Gershwin’s inexperience of instrumentation and the extreme short notice of the approach made to him, the original jazz band material was orchestrated by Whiteman’s arranger, Ferde Grofé (1892-1972).
Rhapsody in blue presents a whole new order of challenge to the re-arranger, since it is a work built originally around a flamboyant concertante part for solo pianist—the composer himself. With the Rhapsody, however, the generic gulf to bridge between classical tradition and jazz is all but eliminated, since Gershwin himself embraced and united elements of both, in his writing as also in his playing. Stefan Malzew’s arrangement effectively turns the original concept on its head by frequently allocating elements of Gershwin’s piano solo part to the cello or the saxophones. The piano’s chordal heft is deployed to add sonority and substance to Gershwin’s weightier harmonic passages of orchestral writing, and several of its original solo contributions remain in place; but the listener’s experience here is one of encountering the familiar ingeniously painted in new colours and the solo/orchestral polarity reversed to agreeably disconcerting effect. In acknowledgement of this and of the odd moment of actual re-composition, Malzew titles his arrangement as Phantasy in blue (no longer ‘Rhapsody’). Most startling, perhaps, is the re-imagining of the original piano solo cadenza in the work’s latter stages, driven at first by the cello and then deployed interactively between cello and saxophones, with the piano’s role confined here to background chordal doubling. The results retain a kinetic, sometimes even percussive energy; yet they enable many moments of enhanced observational intimacy reminiscent of a comment made about a comparable (and comparably successful) work, The Rio Grande (1927) by the British composer Constant Lambert (1905-1951). That work’s dedicatee, the pianist Angus Morrison, commented how ‘it was always Constant’s idea that the piano should be like the “I” of a novel, a central narrator interpreting and reflecting upon the varied episodes that occur in the course of a work and binding them all together into one single subjective experience’. As with Lambert, one feels, so also with Gershwin. In Malzew’s arrangement the solo role conceived by Gershwin has effectively been usurped. By the time the re-composed ending arrives, the piano is, if not dead, then banished somewhat. Long live the cello! Yet the comment by Morrison on Lambert remains apposite and the ‘single subjective experience’ persists, albeit dressed in compellingly fresh colours.
While not for historical purists, these vivid and refreshing arrangements invite us to question anew what might be meant by ‘authentic’ performance, and to remember that things can move in cycles: in the sixteenth century composers of consort music for domestic use scarcely troubled to prescribe any specific instrumentation. Touchstones of the later repertoire include keyboard transcriptions by Bach, Liszt and others of music by myriad other composers. Mozart’s performing edition of Handel’s Messiah introduced clarinets (alien to the Baroque period). Malzew, Gottschick and their colleagues play their necessary part in extending an honourable tradition, as do Alban Gerhardt and the members of the Alliage Quintett. The freedoms of jazz performance practice may inform the arrangers’ modus operandi, but the classical versatility of saxophones and their propensity to blend with the cello are thought-provokingly spotlit in the fastidious and essentially serious re-inventions presented on this recording.
Francis Pott © 2023
In seinen Variationen über ein Rokoko-Thema in A-Dur huldigt Tschaikowsky einem seiner Vorbilder, Mozart, ohne sich auf eine Nachahmung einzulassen. Der Rokoko-Charakter des Werks liegt vor allem in der metrischen Regelmäßigkeit und der geziemenden Zurückhaltung seiner Phrasen, sowie in der klassischen Besetzung mit doppelten Holzbläsern, zwei Hörnern und Streichern (eine deutliche Reduzierung des sonst bei Tschaikowsky üblichen symphonischen Satzes). In der hier vorliegenden Bearbeitung von Stefan Malzew übernimmt das Klavier diskret orchestrale Elemente, die am oberen und unteren Rand des kollektiven Tonumfangs der Saxophone liegen oder darüber hinausgehen, wie z.B. hochfliegende, feingliedrige Holzbläserpassagen oder verdoppelte Basslinien eine Oktave tiefer. Dadurch, dass Malzew die ursprüngliche Cellopartie nicht als sakrosankt betrachtet, schafft er sich größere Freiheit und Vielfalt bei seiner Einrichtung: Zwar steht das Cello im Großen und Ganzen im Vordergrund, doch wird in einigen bedeutenden Passagen das melodische Material an andere Instrumente gegeben—so etwa an das Altsaxophon zu Beginn der 3. Variation und an das Baritonsaxophon in der Mitte von Variation 6.
In der Malzew-Bearbeitung werden Tschaikowskys Holzbläsereinwürfe an Phrasenenden in der 1. Variation von der Saxophongruppe rhythmisch subtil ausgearbeitet, während der Pianist in Variation 2 an den entsprechenden Stellen feine Verzierungen hinzufügt. Das Klavier ist das ideale Medium, um Tschaikowskys ballettartige Holzbläserakkordrepetitionen in der Reprise der 3. Variation wieder erklingen zu lassen. Die 4. Variation bleibt dem Original fast vollständig treu. In der 5. Variation wird Tschaikowskys Flötenmelodie stimmungsvoll von dem Sopransaxophon gespielt, und die Kadenz, die diesen Abschnitt abschließt, erhält eine oder zwei harmonische Andeutungen, die äußerst sensibel hinzugefügt sind.
Bis zu diesem Punkt gab es allen Grund, Malzews Arrangement völlig ernst zu nehmen, und bisweilen sind das Gelingen und die Treffsicherheit seiner Neuinterpretationen staunenswert. Mit den hinzugefügten beiden Anfangstakten der Moll-Variation 6 wird jedoch klar, dass eine unterhaltsame Vertiefung in die Musik nicht unbedingt allzu ernst ablaufen muss. Während die harmonische Substruktur der Originalvariation fast vollständig erhalten bleibt, findet sich Tschaikowsky in einer musikalischen Zeitmaschine wieder, die ihn eineinhalb Jahrhunderte später im Innern eines verrauchten Nachtclubs absetzen soll. Die Musik ist nach wie vor gefühlvoll, aber in einer Weise, die sich der Komponist nicht hätte träumen lassen. Malzew verbietet es uns, die Dinge zu ernst zu nehmen. Zu Beginn von Variation 7 lässt der Blues nach, doch das 21. Jahrhundert hat es nicht so eilig, seinen Griff zu lösen, und so beginnt das Finale in ausgesprochen scharfer und moderner Klangsprache. Dank der geschickten Besetzung haben alle Instrumentalisten eine dynamische und mitreißende Rolle zu spielen, so dass ein durchaus plausibles kammermusikalisches Pendant zu Tschaikowskys Orchestervirtuosität mit seinem klassischen Orchester entsteht. Ein ungeheuerlich reharmonisierter vorletzter Takt erinnert uns jedoch daran, dass es vor allem um den Spaß geht, den Interpreten und Publikum gleichermaßen genießen sollen.
Vivaldis Cellokonzert a-Moll, das im maßgeblichen Vivaldi-Katalog des dänischen Musikwissenschaftlers Peter Ryom unter der Nummer RV418 geführt wird, erfordert von den Instrumentalisten dieser Aufnahme eine längere Zeitreise. Es entstand in den 1720er Jahren und existiert damit seit etwa doppelt so langer Zeit wie Tschaikowskys Variationen in ihrer ursprünglichen Form. Trotzdem zeigt sich eine organischere Angleichung der instrumentalen Anlage zwischen Vivaldis Partitur und dem Arrangement von Itai Sobol, wobei das Saxophonquartett ganz natürlich die Rollen des barocken Streichorchesters übernimmt. Das Klavier pendelt zwischen einer aktualisierten Cembalo-Continuo-Aussetzung, der Vivaldis bezifferter Bass zugrunde liegt, und einer Spielform, die das Haltepedal sowie die Kantabilität des modernen Instruments anerkennt (hier zur Verdopplung und Verstärkung der Saxophone in einer „umherziehenden“ Funktion), hin und her. Vivaldis Konzertsatz nahm zu dieser Zeit bereits den Niedergang des Kontrapunkts als Triebfeder der barocken Kompositionstechnik vorweg. Der erste Satz des a-Moll-Konzerts deutet auf einen späteren, galanteren Stil hin, wobei eine ruhige Einmütigkeit des harmonischen Rhythmus (der oft dem Eindruck energischer Aktivität zuwiderläuft) und konsequente Betonung des ersten Schlags an den Tag gelegt wird. Sobol nutzt die Gelegenheit, den sich langsam bewegenden harmonischen Inhalt zwischen rhythmisch aktiven Tonrepetitionen der Saxophone und darunter liegenden, ausgehaltenen Akkorden des Klaviers aufzuteilen und diesen Dualismus dann umzukehren, um die Struktur vielseitiger zu gestalten.
Der kurze langsame Satz wird von einer homophonen Textur eingerahmt, in der das Klavier melodisch im Vordergrund steht. Zwischen diesen Passagen erklingt eine gefühlvolle Kantilene, in der das ursprüngliche Material des Solocellos erhalten ist, bevor eine eingefügte unbegleitete Kadenz der barocken Praxis Rechnung trägt. Der hektische dritte Satz spiegelt den ersten wider, indem er ein harmonisches Tempo von einem Akkord pro Takt verwendet. Da das tatsächliche Tempo des harmonischen Wechsels den sich schnell bewegenden kurzen Tönen auf der Oberfläche der Klangstruktur entgegenwirkt, fühlt man sich an die anonyme Person erinnert, die später behauptet haben soll, dass aus eben diesem Grund „alle schnelle Musik von Mendelssohn verkappte langsame Musik“ sei. Sicherlich mildert Vivaldis harmonische Handhabung die Energie seiner schnellen Musik mit jener geziemenden Zurückhaltung, was in die Richtung der sich entwickelnden Klassik weist. Sobol unterstreicht diese Auffassung, indem er der rechten Hand des Pianisten im Mittelteil des Satzes eine melodische Bedeutung überträgt, was dem Geschehen einen deutlichen, wenn auch nur unregelmäßig hervortretenden Mozart’schen Anklang verleiht.
Im April 1913 errang der andalusische Komponist Manuel de Falla mit seiner Oper La vida breve bei der Aufführung im französischen Nizza seinen ersten Publikumserfolg. Nachdem er mehrere Jahre lang in Paris gelebt hatte, kehrte de Falla 1914 in seine spanische Heimat zurück und festigte seinen Erfolg mit einem Zyklus spanischer Volkslieder. Auch diese kamen sofort gut an, woraufhin sie orchestriert und für verschiedene Instrumente bearbeitet wurden. Sechs davon wurden für Geige eingerichtet und in dieser Form als Suite populaire espagnole bekannt. Diese recht zufallsbedingte Entstehungsgeschichte hat vielleicht dazu geführt, dass spätere Bearbeiter offenbar das Gefühl hatten, nach Belieben schalten und walten zu können; der Arrangeur Sebastian Gottschick jedenfalls gestattet sich bei seiner Neuinstrumentierung in den Siete canciones populares españolas („Sieben spanische Volkslieder“) etliche Freiheiten.
El paño moruno hebt die Vielseitigkeit des Saxophonensembles hervor. Die Nachahmung von Pizzicato-Basslinien geht später in eine Wiederholung des Hauptthemas über, wobei der prächtige Akkordklang der vier Blasinstrumente einen lebhaften Kontrast zum Vorhergehenden bildet. Insgesamt ist der Satz mit seinen Akzentverschiebungen ein Ohrenschmaus und lässt den Zuhörer raten, wie viele Schläge der Takt hat.
Murcia ist eine Provinz an der Grenze zu Andalusien. Die Seguidilla ist ein leichtfüßiger, dynamischer Tanz im Dreiertakt für zwei Personen, der hier recht kurz gehalten ist und in dem immer wieder abrupte und ausgeprägte Verlangsamungen vorkommen, bevor das vorherrschende Tempo wieder aufgenommen wird.
Asturien ist ein gebirgiges Fürstentum am westlichen Ende der Nordküste Spaniens, das sich durch ein gemäßigtes, feuchtes Klima und üppige grüne Vegetation auszeichnet. In der Einleitung zu Asturiana bettet Gottschick geschickt aufeinanderfolgende Töne aus der Melodiekontur in verschiedene Saxophonstimmen ein, und erzeugt damit einen Klangteppich mit mehreren Überdeckungen; auf diese Weise wird die trostlose, traumähnliche Abgeschiedenheit vorweggenommen, mit der das Solocello seine getragene Melodie singt. Später wird diese Melodie vom Sopransaxophon überlagert, dessen gedämpfte und hängende Glissando-Effekte die Trostlosigkeit noch intensivieren. Die Pianissimo-Sechzehntelfiguren des Klaviers im Hintergrund deuten treffend ein Kontinuum von sanftem Regen an.
Die Jota ist ein in Nordspanien, insbesondere in Aragonien, beliebter Tanz, der in der Regel von Kastagnetten begleitet wird, die vom tanzenden Paar gespielt werden. De Fallas Jota beginnt mit einer leichtfüßigen Figur, bei der es sich um ein Hauptthema oder eine Begleitfigur handeln kann, die in Erwartung einer Melodie erklingt. Die Melodie kommt in Form einer breiteren, getragenen Linie, die schnell träge wird, bevor sie plötzlich wieder der Anfangsstimmung des Satzes weicht.
Nana ist ein sanftes Wiegenlied. Der hypnotische Charakter des Stücks entsteht erstens durch die leisen, obsessiven Wiederholungen des Klaviers und zweitens durch die sich anschließende Interaktion mit einem ähnlichen sich überlappenden Klangteppich, wie er bereits in Asturiana zu hören war. Hier erzeugt das extreme Pianissimo der sich abwechselnden Saxophontöne einen zauberhaften, unheimlichen Effekt, der dem Timbre eines Vibraphons nicht unähnlich ist.
Das flüchtige Canción („Lied“) ahmt teilweise den Eröffnungssatz nach, indem es ein Thema präsentiert, das entweder mit dem letzten oder dem ersten Ton des Taktes beginnt—eine angenehme Zweideutigkeit wird aufrechterhalten. Eine gewisse sprunghafte Zerbrechlichkeit entsteht im Klangbild des Solocellos durch den raffinierten Einsatz von Flageolett (durch leichtes Berühren einer Saite mit dem zweiten Finger entstehen Obertöne). Dies wird dann zum Gegenstand eines imitatorischen Dialogs zwischen dem Alt- und dann dem Sopransaxophon.
Der Polo ist eine musikalische Form des Flamenco, bei der spontane Akzentuierungen die Illusion eines Wechsels zwischen einem schnelleren und einem langsameren musikalischen Puls erzeugt. Dieser Polo von de Falla bildet hier ein äußerst kurzes Finale, das abrupt endet, jedoch nicht bevor die ungezügelte Wildheit der Musik durch hochfliegende Oktaven zwischen dem Solocello und dem Sopransaxophon anschaulich vermittelt wurde, wobei letzteres bei Bedarf seine Neigung zu einem theatralischen Anflug von Hysterie offenbart.
Sebastian Gottschick bestätigte, dass diese Bearbeitungen sowohl verschmitzt-spaßhaft gemeint, und gleichzeitig auch vom Geist des Jazz durchdrungen sind. Er wies darauf hin, dass er während seiner Arbeit an der Partitur von de Falla auch George Gershwins Porgy and Bess arrangierte, wobei er besonders von der Nummer „Here come de honey man“ in der Interpretation von Miles Davis und Gil Evans von 1958 angetan war. Gottschick fertigte daraufhin seine eigene Version des Lieds als Hommage an Davis und Gershwin an. Es ist mehrfach vorgekommen, dass diese Version unter dem Titel „Intermezzo ad lib.“ spielerisch zwischen Fallas Nana und Canción eingefügt wurde, obwohl sie in der vorliegenden Aufnahme nicht enthalten ist.
Schostakowitsch komponierte die Filmmusik zu Die Stechfliege im Jahr 1955. Das Drehbuch schildert das Leben eines verwegenen Helden im Italien des frühen 19. Jahrhunderts. Der Film hatte in der Sowjetunion hohe Einschaltquoten, doch ist die Musik bekannter in der Form der Konzertsuite, die der Freund des Komponisten, Levon Atovmian, später einrichtete. Das hier vorliegende Prélude bleibt inhaltlich und stilistisch nah an Atovmians schlichter Bearbeitung für zwei Violinen und Klavier in einer Zusammenstellung, die auch eine Elegie aus Schostakowitschs Begleitmusik (ursprünglich für kleines Orchester, op. 37, 1933-34) zu dem Theaterstück Die menschliche Komödie (nach Balzac) enthält. In beiden Stücken wird der Klavierpart von Atovmians Transkription beibehalten, und das Cello und ein Solo-Baritonsaxophon spielen die Violinstimmen eine Oktave tiefer als ursprünglich notiert (einen kurzen Moment lang sogar zwei Oktaven tiefer), was ihnen eine neue herbstlich anmutende Dimension verleiht, die in der Elegie eine ausgesprochen Schubert’sche, langsame Ländlermelancholie aufgreift.
Schostakowitschs achtsätzige Suite für Varieté-Orchester entstand nach 1956, lässt sich allerdings nicht genau datieren. Die Originalbesetzung umfasst zwei Alt- und zwei Tenorsaxophone sowie weitere Holzbläser, ein komplettes Blechbläserensemble, Harfe, zwei Klaviere (von denen eines eine Celesta verdoppelt), drei Schlagzeuger, die eine Vielzahl von gestimmten und ungestimmten Instrumenten spielen, und Streicher. Der Walzer Nr. 2 in c-Moll mag beim Hörer aufgrund unerwarteter Wiedererkennung für angenehme Überraschung sorgen, denn seine Atmosphäre des „verwunschenen Ballsaals“ sollte die Aufmerksamkeit etlicher Musikredakteure vom Fernsehen und Film wecken. In Louis-Noël Fontaines Arrangement beschränkt sich das Klavier auf eine unerschütterliche rhythmische und harmonische Humpta-Rolle, wobei der melodische Faden zwischen den Saxophonen hin- und hergereicht wird und das Cello diese entweder im Unisono verdoppelt oder selbst solistisch auftritt. Die eher nostalgische zweite Episode in Dur führt zu einem lebhaften Hintergrund mit laufenden Triolen, deren zunehmend chromatische Konturen zwischen den Melodietönen hindurchschleichen. Wenn Schostakowitsch wirklich einen Ballsaal im Sinn hatte, könnte es derjenige der RMS Titanic gewesen sein.
George Gershwins Rhapsody in blue wurde 1924 von dem New Yorker Bandleader Paul Whiteman in Auftrag gegeben. Da Gershwin zu diesem Zeitpunkt in Instrumentierungsfragen noch unerfahren war und die Anfrage extrem kurzfristig kam, wurde das ursprüngliche Jazzband-Material von Whitemans Arrangeur Ferde Grofé (1892-1972) orchestriert.
Die Rhapsody in blue stellt den Bearbeiter vor ganz neue Herausforderungen, da es sich hierbei um ein Werk handelt, das ursprünglich um eine aufwändige konzertante Partie für Soloklavier—gespielt vom Komponisten selbst—herum konstruiert worden war. Allerdings ist in der Rhapsody die Kluft zwischen klassischer Tradition und Jazz so gut wie überwunden, da Gershwin sich sowohl in seinen Kompositionen als auch in seinem Spiel Elemente aus beiden Bereichen zu eigen gemacht und vereint hatte. Stefan Malzews Arrangement stellt das ursprüngliche Konzept sozusagen auf den Kopf, indem Elemente des ursprünglichen Klaviersoloparts häufig dem Cello oder den Saxophonen zugewiesen werden. Die akkordische Ausdrucksstärke des Klaviers wird eingesetzt, um Gershwins gewichtigeren harmonischen Passagen der Orchesterkomposition Klangfülle und Substanz zu verleihen. Mehrere der ursprünglichen Solobeiträge bleiben erhalten, doch erlebt der Hörer hier, wie das Vertraute einen erfinderischen neuen Anstrich erhält und die Polarität von Solo und Orchester in zugleich anregender und beunruhigender Weise umgekehrt wird. Angesichts dessen hat Malzew seiner Bearbeitung einen neuen Titel verliehen und sie nicht als „Rhapsody“ sondern als Phantasy in blue bezeichnet. Am verblüffendsten ist vielleicht die Neuinterpretation der ursprünglichen Solokadenz des Klaviers gegen Ende des Werks, die zunächst vom Cello übernommen und dann interaktiv vom Cello und den Saxophonen bestritten wird, wobei sich die Rolle des Klaviers hier auf eine akkordische Verdopplung im Hintergrund beschränkt. Das Ergebnis behält eine kinetische, manchmal sogar perkussive Energie, doch gleichzeitig ergeben sich zahlreiche Momente verstärkter Vertrautheit und des Beobachtens, die an eine Bemerkung über ein vergleichbares (und vergleichsweise erfolgreiches) Werk erinnern—The Rio Grande (1927) von dem britischen Komponisten Constant Lambert (1905-1951). Der Widmungsträger dieses Werks, der Pianist Angus Morrison, bemerkte: „Constant war immer der Überzeugung, dass das Klavier wie das „Ich“ eines Romans auftreten sollte, ein zentraler Erzähler, der die verschiedenen Episoden, die im Verlauf eines Werks auftreten, interpretiert und reflektiert und sie alle zu einer einzigen subjektiven Erfahrung zusammenfügt.“ Wie bei Lambert, so scheint es, verhält es sich auch bei Gershwin. In Malzews Bearbeitung wurde die von Gershwin vorgesehene Solorolle praktisch verdrängt. Wenn der neu komponierte Schluss kommt, ist das Klavier zwar vielleicht nicht tot, aber doch mehr oder minder vertrieben. Es lebe das Cello! Doch Morrisons Bemerkung über Lambert ist nach wie vor zutreffend, und die „einzige subjektive Erfahrung“ bleibt bestehen, wenn auch in einem überzeugend neuen Gewand.
Zwar richten sie sich nicht an historische Puristen, doch fordern diese lebendigen und erfrischenden Arrangements dazu auf, erneut zu hinterfragen, was mit einer „authentischen“ Aufführung gemeint sein könnte. Außerdem wird daran erinnert, dass sich die Dinge in Zyklen bewegen können: im 16. Jahrhundert machten sich die Komponisten von Consort-Musik für den Hausgebrauch kaum die Mühe, eine bestimmte Instrumentierung vorzuschreiben. Zu den Meilensteinen des späteren Repertoires gehören die Transkriptionen für Tasteninstrumente von Bach, Liszt und anderen von Musik unzähliger weiterer Komponisten. Mozart führte in seiner praktischen Ausgabe von Händels Messias Klarinetten ein (die dem Barock fremd waren). Malzew, Gottschick und ihre Kollegen tragen ihren Teil dazu bei, eine ehrwürdige Tradition fortzuführen, ebenso wie Alban Gerhardt und die Mitglieder des Alliage Quintetts es mit ihren Interpretationen tun. Die Freiheiten der Jazz-Aufführungspraxis mögen den Modus Operandi der Arrangeure prägen, doch die klassische Vielseitigkeit des Saxophons und seine Tendenz, mit dem Cello zu harmonieren, bieten in den anspruchsvollen und im Wesentlichen ernsthaften Neueinrichtungen, die auf dieser Einspielung präsentiert werden, interessante Denkanstöße.
Francis Pott © 2023
Deutsch: Viola Scheffel
Daniel Gauthier: … which left us wondering how a cello might match with saxophones …
Alban: … and four months later you gave me a short arrangement of Tchaikovsky’s Rococo Variations. We all met in Eindhoven two hours before I was due to rehearse Unsuk Chin’s cello concerto.
Daniel: We arrived with only a few sketches and drafts that our arranger had prepared earlier, and while nothing was yet fully fleshed out, we were able to play something.
Alban: I was astonished, having previously believed the combination would not work. I thought the saxophones with their rich and beautiful sound would drown out the cello, but that wasn’t the case. Maybe it’s the way you handle your instruments that leaves so much room for me to interpret—our different instruments definitely complement each other rather well.
Daniel: Oh, believe me, we could blow you out of any concert hall at any time, my dear, but we love the challenge of allowing the cello to shine as the solo instrument while we create a transparent texture akin to a full orchestra—not the easiest of tasks, but so very rewarding!
Alban: Over a year later we met again to work on the Tchaikovsky and the Falla, and I really loved diving deeper into the delicious arrangements—especially those in which the arrangers dared to fool around with the original score and to take inspiration from the range of colour that four saxophones can produce …
Daniel: … like in the slow variations of the Tchaikovsky, where at times the cello takes on an accompanimental role as the melody shifts to the tenor sax, or when the penultimate variation turns into a blues—what an unexpected surprise! (While we see ourselves as primarily classical saxophonists, we do enjoy the occasional excursion into the jazz world!)
Alban: It took us a while to finalize the repertoire for this album, but we knew pretty early on that it would comprise an eclectic and colourful mix of works—we wanted to show as much variety of this newly established group as possible. At some point you asked me how I’d feel about Gershwin’s Rhapsody in blue, and I immediately jumped on that suggestion as it was the first piece outside of the classical music world that I fell in love with as a child, and I have been fascinated by it ever since. (In my teens, when I was still a pianist, I even used to play the piano part myself.)
Daniel: We were delighted when you went for it, and after overcoming some difficulties during rehearsals in which we had to tweak the arrangement slightly, we had so much fun recording it, wouldn’t you agree? For us, the biggest challenge was tackling the sound of a string orchestra for the Vivaldi, as it is such a unique timbre.
Alban: But I must say the sonority of your saxophones, supported by the clear sound of the piano, somehow made complete sense for this Baroque repertoire. Particularly in the slow movement, it felt like being accompanied by a beautiful organ. And although we obviously didn’t attempt to replicate an authentic Baroque performance, we approached the Vivaldi differently to the rest of the repertoire on this recording …
Daniel: … by cutting down on the vibrato, for example. I imagine Vivaldi may well have enjoyed our taking a different approach to his music, as it was not unusual for composers of the day to repackage works (both their own and others’) in various forms.
Alban: Perhaps even Gershwin would have liked our little arrangement of his masterpiece—we can only hope!
Alban Gerhardt & Daniel Gauthier © 2023

